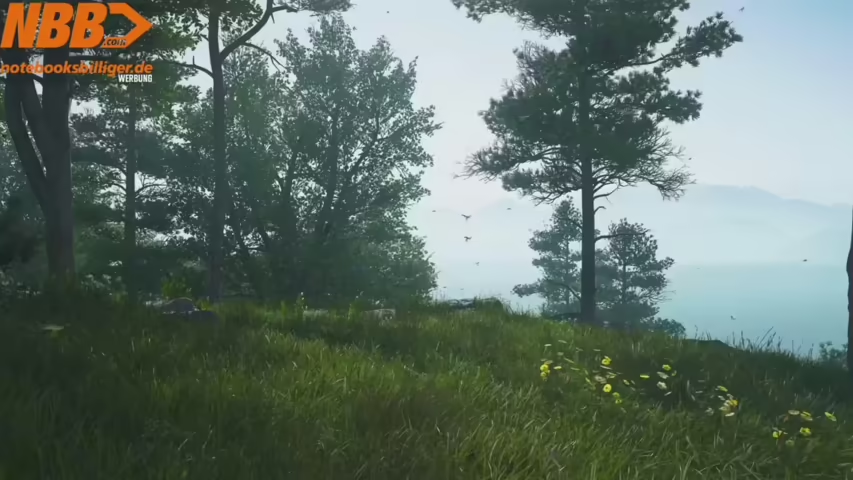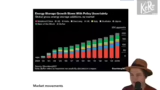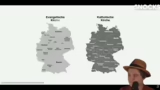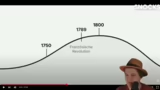Ein "Boomer-Soli" rettet die Rente? + Reiche will Beteiligung von Ökostrom-Betreibern am Stromnetzausbau + Trump will Rohrzucker in Cola.
Trump, Boomer-Soli, Kirchenfinanzen: Politische Debatten und Rentenreformen
Trump versucht mit Ablenkungsmanövern von innenpolitischen Problemen abzulenken. Das DIW schlägt einen Boomer-Soli zur Rettung des Rentensystems vor. Kirchenfinanzen bleiben intransparent. Weitere Themen: Klimaneutralität, Raumfahrt, Steuergerechtigkeit und die Debatte um die Bundesverfassungsrichterwahl.
Trumps Ablenkungsmanöver und Speicherthematik
00:25:08Trump versucht von innenpolitischen Problemen abzulenken, indem er Coca-Cola vorschreibt, Rohrzucker statt Kornsirup zu verwenden, was jedoch tausende amerikanische Jobs kosten könnte. Es wird vermutet, dass dies ein Ablenkungsmanöver ist, um von den Epstein-bezogenen Problemen abzulenken. Die PR-Antwort von Coca-Cola wird als übertrieben und witzig empfunden. Des Weiteren wird die Speicherthematik angesprochen, bei der Bloomberg oder das Energieministerium plant, den Ausbau von Energiespeichern zu verlangsamen, obwohl es dafür keine offensichtlichen Gründe gibt. Trotz des Widerstands der fossilen Lobby und falscher Berechnungsgrundlagen wird erwartet, dass der Zubau von Solarenergie aggressiver sein wird als geplant, da die Preise schnell fallen. Es wird auch die Kostenbeteiligung von Ökostrombetreibern am Stromnetzausbau diskutiert, die von Wirtschaftsministerin Katharina Reiche gefordert wird, was zu einer Aktusdiskussion führt. Es wird befürchtet, dass dies zu einer Kürzung der Förderung erneuerbarer Energien führen könnte, was als absurd kritisiert wird.
Trump, Zentralbankchef und Rhetorik
00:34:32Es wird über Trumps widersprüchliches Verhalten bezüglich der Entlassung des Zentralbankchefs Paul diskutiert. Jede Person, die Trump Kompetenz zuschreibt, wird als Vollidiot bezeichnet, da sein Verhalten als inkompetent und kindisch wahrgenommen wird. Trump wies Spekulationen über eine Entlassung des Zentralbankchefs Paul zurück, obwohl er es vorher gesagt hatte. Es wird angedeutet, dass Trump bereits eine Ausrede vorbereitet, falls Powell wegen Betrugs gehen muss. Trumps Rhetorik wird im Vergleich zu Obama als qualitativ minderwertig kritisiert. Es wird die Frage aufgeworfen, was Trump mit 'aufräumen' meint, da seine Bilanz bisher schlecht ist und die Inflation steigt. Es wird angemerkt, dass viele Leute nur die Überschriften lesen und dann sofort zurückrudern müssen, wenn sie merken, dass es Unsinn ist.
Boomer-Soli und Rentensystem
00:43:05Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) schlägt einen "Boomer-Soli" vor, bei dem reichere Rentner der Babyboomer-Generation für ärmere Rentner im gleichen Alter zahlen sollen. Dieser Vorschlag stößt auf breite Kritik, wird aber vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) gelobt und könnte eine neue Debatte auslösen. Der Vorschlag zielt darauf ab, die Belastung des Rentensystems durch die alternde Bevölkerung zu verringern und jüngere Generationen zu entlasten. Es wird vermutet, dass sich der Vorschlag zunächst nur auf Renten bezieht, aber möglicherweise auch Pensionäre einschließt. Es wird betont, dass die gesetzliche Rentenversicherung angesichts der Babyboomer-Generation vor großen Herausforderungen steht und Maßnahmen wie eine Vermögenssteuer oder die Zusammenführung verschiedener Rententöpfe erforderlich sind, um das System aufrechtzuerhalten. Es wird kritisiert, dass die Mittelstandsbeauftragte der Bundesregierung, Konnemann, den Vorschlag ablehnt und die Verlässlichkeit für Rentner gefährdet sieht. Es wird die Frage aufgeworfen, warum man Jüngeren einfach 3-8% wegnehmen kann, während dies bei Rentnern als unzumutbar angesehen wird. Es wird vorgeschlagen, alle Rententöpfe und Kassen zusammenzufassen, um das System zu harmonisieren und zu vereinfachen.
Versorgungswerke, Riester-Rente und Rentenreform
00:50:46Es wird über die Probleme mit Versorgungswerken für Zahnärzte diskutiert, bei denen sich einige mit risikoreichen Geldanlagen verspekuliert haben, was die Altersversorgung von mehr als 10.000 Medizinern gefährdet. Es wird argumentiert, dass es sinnvoller wäre, diese Gelder in einen gemeinsamen Topf zu legen. Es wird die Frage aufgeworfen, wie politisch einflussreiche Generationen es geschafft haben, für sich vorzusorgen, wobei jedoch auch darauf hingewiesen wird, dass dies nur für einen Teil der Bevölkerung gilt. Es werden bestimmte Modelle wie Riester-Rente und Rürup kritisiert, da sie in den meisten Fällen wenig Nutzen bringen. Es wird erwähnt, dass andere Länder wie Schweden und Norwegen andere Ansätze verfolgen, die möglicherweise sicherer sind. Es wird erwartet, dass eine Rentenreform ansteht, bei der man sich nicht einmal andere Länder anschaut, wenn die Kommission etwas vorgelegt hat. Es wird die persönliche Erwartung geäußert, dass man von der gesetzlichen Rente nicht viel sehen wird, da man als Selbstständiger nicht großartig einzahlt. Es wird jedoch auch darauf hingewiesen, dass sich die angespannte Lage des Rentensystems in 10-20 Jahren wieder ausgleichen wird, wenn die Babyboomer-Generation in Rente geht.
Klimaneutralität und Rechenzentren in der Hightech-Agenda
01:09:07Die Hightech-Agenda, gesteuert vom BMFTR, zielt auf Klimaneutralität 2045 ab und berücksichtigt neue Technologien. Rechenzentren, wichtig für künstliche Intelligenz, fordern eine Stromsteuersenkung. Es wird diskutiert, ob Rechenzentren als produzierendes Gewerbe eingestuft werden sollten. Trotz Investitionen in Forschung und Technologie muss gespart werden, insbesondere bei konsumtiven Ausgaben. Die Senkung der Netzentgelte ist positiv, bringt aber nur geringe Entlastung. Eine umfassendere Stromsteuersenkung wäre sinnvoller, wird aber von der Haushaltslage abhängig gemacht. Trotzdem sind enorme Geldsummen vorhanden, die jedoch nicht effizient für Strukturreformen eingesetzt werden, was zu Unmut führt. Die Verlagerung von LNG-Infrastrukturkosten ins Sondervermögen ermöglicht es der Region, Mittel für andere Zwecke wie Mütterrente und Gastrosteuer zu verwenden, was kritisiert wird.
Gastronomie-Steuer und Mütterrente: Prioritäten und Gerechtigkeit
01:13:20Die Gastro-Steuer wird als Entlastung für große Ketten wie McDonald's kritisiert, während kleine Betriebe im ländlichen Raum unterstützt werden sollen. Es wird argumentiert, dass die Gastro die Preise wahrscheinlich nicht senken wird und andere Unternehmen im Dienstleistungssektor benachteiligt werden. Die Schaffung von Ankerzentren wird befürwortet, um Begegnungen zu ermöglichen. Die Mütterrente wird als Frage der Gerechtigkeit dargestellt, insbesondere für Mütter, die zu Zeiten fehlender Betreuungsmöglichkeiten Kinder bekommen haben. Kritisiert wird, dass die Mütterrente einkommensunabhängig ist und somit auch Besserverdienende profitiert, anstatt gezielt armutsgefährdeten Müttern zu helfen. Stattdessen wird eine Rentenreform gefordert, die die strukturellen Herausforderungen angeht, um auch jungen Menschen eine Chance auf Rente zu ermöglichen.
Raumfahrtprogramm und Unabhängigkeit in der Raumfahrt
01:21:01Es wird betont, wie wichtig es ist, die ESA zu fördern, um unabhängiger von der NASA und den USA zu werden. Das Engagement von Habeck im Bereich Raumfahrt wird hervorgehoben, insbesondere die finanzielle Unterstützung des ersten Raketenstarts von Isar Aerospace. Es wird betont, dass Raumfahrt wichtig für Klimaschutz und Ernährung ist. Die Abhängigkeit von Elon Musk wird kritisiert. Ein CDU-Abgeordneter aus Düsseldorf wird für seine Unterstützung von ISA Aerospace gelobt. Deutschland kommt gemeinsam mit der Europäischen Union und der ESA im Bereich Raumfahrt voran. Es wird die ESA-Ministerratskonferenz in Bremen erwähnt. Unabhängigkeit und Souveränität in Deutschland und Europa sind wichtig, um in einem friedlichen Land leben zu können.
Klimageld, Digitalsteuer und weitere politische Fragen
01:24:19Die Einführung eines Klimageldes wird diskutiert, wobei betont wird, dass es sich um einen Ausgleichsmechanismus zu CO2-Abgaben handelt. Kritisiert wird, dass Klimagelder derzeit für Gaskonzerne verwendet werden. Die Ausweitung der Mütterrente wird als Fehler betrachtet. Die Besteuerung großer Tech-Konzerne wird als notwendig erachtet, jedoch wird eine detaillierte Prüfung gefordert, um Schäden für heimische Unternehmen zu vermeiden. Es wird die Notwendigkeit gemeinsamer Regeln auf EU-Ebene betont. Die Frage, ob Habeck und Baerbock sich aus der deutschen Politik zurückziehen sollen, wird aufgeworfen. Ein Untersuchungsausschuss zu Spahns Maskenbestellungen wird abgelehnt, stattdessen wird eine Enquete-Kommission bevorzugt. Die Wahl eines Richters wird aufgrund von Inkompetenz und fehlender Mehrheit kritisiert. Jens Spahn wird trotz seiner Fehler als guter Politiker bezeichnet, was auf Kritik stößt.
Auswahl der Themen und Reaktionen auf CDU-Strategie
01:50:53Es werden verschiedene Themen für die Sendung vorgestellt, darunter ein Beitrag über die Regenbogenfahne, ein gehacktes Video von Nios, der Reichtum der Kirche und eine Diskussion zwischen Lanz und Hasselmann. Zudem wird das Wetter nur bei Erreichen eines Abzocke-Abo-Ziels behandelt. Die Befürchtung geäußert, dass die CDU sich immer mehr an die AfD annähert, was sich in der Verbreitung von Fake News äußert. Die Frage nach E-Autos wird verneint, während gleichzeitig ein Abzock-Sub-Goal kritisiert wird. Es wird die Irritation darüber ausgedrückt, dass andere Themen wenig Stimmen erhalten. Die Wahl der CDU wird als Wunsch nach Verarschung interpretiert, wobei die Wähler als Steuergeldverschwender und Verbreiter dummer Inhalte wahrgenommen werden. Markus Lanz setzt sich bei einer Abstimmung durch, was Verwunderung auslöst.
Interne Einblicke in die CDU-Fraktion und Kritik an Jens Spahn
01:55:40Ein Einblick in die CDU-Fraktion gegeben, wobei ein CDU-Politiker erwähnt wird, dessen Hauptinhalt aus dem Verbieten des Genderns besteht. Es wird kritisiert, dass viele Abgeordnete erst kurz vor der entscheidenden Sitzungswoche über die Thematik informiert waren, was als mangelnde Vorbereitung kritisiert wird. Die Theorie, dass die CDU von Spahns Richterwahl ablenken wollte, wird als unlogisch abgetan. Es wird betont, dass die meisten Abgeordneten sich eine eigenständige Meinung gebildet haben und es ein Spannungsfeld zwischen Stabilität und Prinzipien gibt. Die Kritik richtet sich gegen Jens Spahn wegen eklatanten Führungsversagens bei der Vorbereitung der Richterwahlen. Es wird hervorgehoben, dass es bereits vor Wochen einen gemeinsamen Vorschlag gab, der nun von der CDU in Frage gestellt wird, was als erbärmlich bezeichnet wird.
Vorwürfe und Abläufe hinter den Kulissen der CDU
02:01:34Der Fokus liegt auf der Frage, wie Jens Spahn die Fraktion auf die Richterwahlen vorbereitet hat, wobei der Eindruck entsteht, dass dies nicht ausreichend geschehen ist. Es wird betont, dass es bereits Anfang Juni ein Treffen gab, bei dem ein gemeinsamer Vorschlag für die Richterwahlen präsentiert wurde. Die Bedeutung einer breiten Unterstützung im Parlament für die Kandidaten wird hervorgehoben. Der Plagiatsvorwurf gegen eine Kandidatin wird als Hilfskonstruktion dargestellt, die schnell zusammengebrochen ist. Es wird kritisiert, dass Jens Spahn und Friedrich Merz die Mehrheitsverhältnisse in der Fraktion verschleiern wollten. Einblicke in die Vorbereitung von Fraktionen auf wichtige Entscheidungen gegeben, wobei die Rolle von Fachpolitikern und Experten betont wird. Die Bedeutung von Kompromissbereitschaft und Mehrheitsfindung in der Demokratie wird hervorgehoben, wobei kritisiert wird, dass die CDU diesmal Schwierigkeiten hat.
Diskussion über die Bundesverfassungsrichterwahl und Gewissensentscheidungen
02:11:11Die Diskussion dreht sich um die Bundesverfassungsrichterwahl und die Frage, ob der Prozess optimal verlaufen ist. Es wird betont, dass die Vorbehalte im Vorfeld hätten adressiert werden müssen. Jens Spahn habe die Diskussion frühzeitig an die SPD-Fraktion weitergegeben, da die Mehrheit wackelig war. Die Notwendigkeit einer breiten Akzeptanz bei der Wahl der Verfassungsrichter wird betont. Es wird die Frage aufgeworfen, ob der Auftritt einer Kandidatin die Haltung der Beteiligten verändert hätte. Der Begriff Bioethik wird diskutiert. Es wird argumentiert, dass die Angriffe auf eine Kandidatin auf Fake News basieren und ihre Positionen nicht so kontrovers sind, wie dargestellt. Die Politik, insbesondere Union und SPD, werden kritisiert, die Kandidatin nicht ausreichend unterstützt zu haben. Es wird die Frage aufgeworfen, wie Richter gewählt werden sollen, wenn jeder Aspekt zur Gewissensfrage wird, und wie weit man bereit ist, Kompromisse einzugehen.
Analyse des Prozesses der Richterwahl und Kritik an der Unionsführung
02:23:04Es wird analysiert, was bei der Richterwahl medial und hinter den Kulissen passiert ist. Die Union darf Kandidaten ablehnen, aber die eigene Führung kennt die eigenen Leute nicht. Die Unionsführung, insbesondere Spahn und Merz, wird kritisiert, die eigenen Leute nicht zu kennen und die Situation falsch eingeschätzt zu haben. Es wird als Skandal bezeichnet, wie mit der Kandidatin umgegangen wurde, und dass die Hausaufgaben nicht gemacht wurden. Es wird betont, dass es legitim ist, Skepsis anzumelden, aber nicht am Tag der Wahl, wenn man sich nicht ausreichend informiert hat. Die Kernthemen der Union müssen vertreten werden, aber es darf nicht zu einer Gesetzesänderung kommen. Die Einschätzung einiger Leute, dass eine Richterin sofort Gesetze ändern würde, wird als unrealistisch dargestellt. Es wird die Frage aufgeworfen, wie weit man bereit ist, Kompromisse einzugehen, und dass die Demokratie funktionieren muss.
Debatte über Gewissensentscheidungen und die Rolle des Verfassungsgerichts
02:29:51Es wird darüber diskutiert, dass die Debatte über die Richterwahl am Tag der Wahl stattfindet und dass der Prozess nicht gut gelaufen ist. Es geht um ein bestimmtes Verständnis von Leben und Würde, das die Bundesrepublik durchzieht. Der Vorschlag der Grünen wurde abgelehnt, was zu einer Blockade der eigenen Vorschläge geführt habe. Es wird kritisiert, dass die aktuelle Debatte inhaltlich leer sei und es keine graduierten Gewissensentscheidungen gebe. Es wird betont, dass jede Entscheidung eine Abwägungssache ist und dass es einen Unterschied macht, ob man über eine politische oder eine Personalie entscheidet. Der Begriff Artikel 1 in Verbindung mit Verfassungsgericht wird als höchste Flughöhe bezeichnet. Es wird kritisiert, dass Jens Spahn den Fehler gemacht habe und dass die Forderung, die Abgeordneten zu zwingen, infam sei. Es wird betont, dass man selber wissen muss, wie gravierend das Thema ist, über das man entscheidet.
Auseinandersetzung um die Kandidatin für das Bundesverfassungsgericht und Jens Spahns Rolle
02:33:34Die Diskussion dreht sich um die Kandidatin für das Bundesverfassungsgericht und die Frage, ob Jens Spahn einen Fehler gemacht hat. Es wird kritisiert, dass Spahn einen Welpenschutz genießt, obwohl er bereits viel Kritik auf sich gezogen hat. Die CDU/CSU wird dafür kritisiert, dass sie sich von der AfD nicht ausreichend abgrenzt und dass es keine offene Abstimmung und Vorbereitung in der Fraktion gab. Es wird betont, dass es wichtig ist, das Verfassungsgericht vor Diskreditierung zu schützen. Die Kritik an der Kandidatin basiert oft auf Fake News und einer falschen Darstellung ihrer Positionen, insbesondere zum Thema Abtreibung. Es wird klargestellt, dass die aktuelle Rechtslage Abtreibung nicht legalisiert, sondern lediglich auf Strafbarkeit verzichtet. Die Ampelkoalition wird kritisiert, einen Gesetzesentwurf zur Neuregelung des Schwangerschaftsabbruchs ohne Einbeziehung der Opposition eingebracht zu haben. Es wird betont, dass die Kandidatin nicht als Aktivistin nach Karlsruhe will, sondern eine wissenschaftliche Position vertritt. Die Diskussion wird als unsachlich und von Kampagnen geprägt kritisiert, wobei insbesondere der CDU-Politiker Ploss für seine faktenfreien Aussagen kritisiert wird.
Diskussion über die Zuständigkeit des Senats beim Bundesverfassungsgericht und Kritik an der Darstellung der Kandidatin
02:49:34Es wird klargestellt, dass die Abtreibungsfrage in der Regel vom ersten Senat des Bundesverfassungsgerichts behandelt wird, nicht vom zweiten Senat, für den die Kandidatin vorgesehen war. Die Diskussion über die Kandidatin wird als unsinnig und bescheuert bezeichnet. Es wird eingeräumt, dass der zweite Senat mittlerweile auch über Grundrechtsfragen entscheidet, was eine Auseinandersetzung mit dem Thema Menschenwürde denkbar macht. Es wird betont, wie wichtig ein breiter Konsens im Bundestag bei einer Reform des Abtreibungsrechts wäre, um eine Spaltung der Gesellschaft zu vermeiden. Die Darstellung, dass die Kandidatin als Aktivistin nach Karlsruhe will, wird als falsch zurückgewiesen. Es wird kritisiert, dass die CDU mit ihrer Kampagne gegen die Kandidatin Muster der AfD übernimmt und die Demokratie gefährdet. Es wird betont, dass die Art und Weise, wie mit der Kandidatin umgegangen wurde, inakzeptabel ist und dass es sich nicht um eine rein inhaltliche Debatte handelt.
Kontroverse um den gesellschaftlichen Kompromiss zum Schwangerschaftsabbruch und die Rolle der Union
02:55:59Es wird betont, dass die Union zu dem gesellschaftlichen Kompromiss zum Schwangerschaftsabbruch steht, der in den 90er Jahren geschaffen wurde, obwohl er aus Unionssicht schmerzhaft ist. Es wird argumentiert, dass es im Sinne des Friedens in der Gesellschaft wichtig ist, Brücken zu anderen Positionen zu bauen und das Selbstbestimmungsrecht der Frau zu respektieren. Es wird darauf hingewiesen, dass Umfragen zeigen, dass eine Mehrheit der Gesellschaft für die Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen in den ersten 12 Wochen ist. Es wird befürchtet, dass eine Auflösung des Kompromisses zu Konflikten führen könnte, wie sie in den USA und Polen zu beobachten sind. Es wird kritisiert, dass die Konservativen und Rechtsaußenleute die Debatte auf den Paragraphen 218 lenken wollen, obwohl dies nicht die eigentliche Relevanz des Themas ist. Es wird betont, dass es um die Frage geht, warum eine Richterwahl am Bundesverfassungsgericht scheitert, weil Jens Spahn und Friedrich Merz in ihrer Fraktion nichts abgesichert haben.
Diskussion über Kirchenfinanzen und Vermögen
03:09:02Der Streamer geht auf das Thema Kirchenfinanzen ein, inspiriert durch ein Video von „Simply“. Er erwähnt, dass die Ampelkoalition versuchte, Staatsleistungen einzuschränken, was jedoch scheiterte. Es wird auf Sonderrechte und alte Gesetzgebungen hingewiesen, die noch aus der Weimarer Verfassung stammen. Das Video von „Simply“ behandelt die undurchsichtigen Unternehmensstrukturen und das gigantische Vermögen der Kirchen, das niemand genau kennt. Es wird kritisiert, dass die Kirchen zwar Milliarden kassieren, aber wenig Transparenz zeigen. Der Streamer erwähnt, dass er mit institutionellem Glauben nichts anfangen kann und es als Zeitverschwendung betrachtet. Das Video zeigt, dass weder die katholische noch die evangelische Kirche regelmäßig veröffentlichen, wie viel Vermögen sie insgesamt haben, sondern nur Informationen von einzelnen Bistümern und Landeskirchen. Es wird erwähnt, dass das Erzbistum Köln ein Vermögen von über 4 Milliarden Euro hat. Das Video setzt einen Datenspezialisten namens Yannick ein, um die Bilanzen zusammenzusuchen und einen Experten für Kirchenfinanzen zu finden.
Excel-WM und Kirchenfinanzen
03:20:07Es gibt eine jährliche Excel-WM im Battle Royale-System, die 2023 in Las Vegas stattfand. Der Streamer erwähnt einen Experten für Kirchenfinanzen, Carsten Frerk, und plant ein Interview mit ihm in einer Kirche. Trotz anfänglicher Absagen aufgrund von Bedenken des Gemeindekirchenrats, eine Kirche als Kulisse zu nutzen, wird schließlich eine Kirche in Berlin gefunden, die Immanuel-Kirche, wo das Treffen stattfinden soll. Kirchen sind oft schlecht beheizt, was ein Problem darstellt. Um reich zu werden, benötigt die Kirche Einnahmen, hauptsächlich durch die Kirchensteuer, die in der Regel 9% der Einkommensteuer beträgt. Bei einem Brutto-Jahresgehalt von 42.000 Euro zahlt eine ledige Person ohne Kinder rund 467 Euro jährlich an die Kirche. Die Kirchensteuer wird vom Finanzamt eingezogen, außer in Bayern, wo es spezielle Kirchensteuerämter gibt. Obwohl Staat und Kirche getrennt sind, gibt es eine kooperative Zusammenarbeit, bei der die Kirchen öffentliche Aufgaben wie Krankenhäuser und Kindergärten übernehmen und dafür Privilegien erhalten, darunter das Recht, Steuern zu erheben. Früher wurde dies im Mittelalter als Zehnt bezeichnet.
Kirchensteuer, Staatsleistungen und Vermögen
03:25:33Preußen führte im 19. Jahrhundert eine frühe Form der Kirchensteuer ein, die in der Weimarer Republik verfassungsrechtlich verankert wurde. Die Einnahmen belaufen sich auf etwa 13 Milliarden Euro jährlich. Der Staat erhält für die Eintreibung etwa 300 Millionen Euro als Aufwandsentschädigung. Die Kirchen nutzen die Einnahmen hauptsächlich für Personalkosten. Ein Großteil der Kosten für kirchliche Krankenhäuser und Kindergärten wird vom Staat übernommen. Zusätzlich gibt es Staatsleistungen, die aus Entschädigungen von vor 200 Jahren resultieren, als Kirchen Ländereien an Fürsten abgeben mussten. Diese Leistungen belaufen sich auf über 500 Millionen Euro jährlich. Trotz des politischen Willens seit über 100 Jahren, diese Zahlungen abzuschaffen, ist dies bisher nicht geschehen. Die Kirchen fordern eine hohe Ablösesumme, um die ausbleibenden Gelder selbst erwirtschaften zu können. Die frühere Ampelregierung ließ dies durchrechnen, aber eine Einigung scheiterte. Die Kirchen haben bisher viel Geld erhalten, aber es gibt keine Einigung über die Ablösung der Staatsleistungen. Die evangelische Kirche strebt einen Wertersatz nach dem Äquivalenzprinzip an, während die katholische Kirche sich nicht einheitlich äußert. Das Thema bleibt bestehen, ähnlich wie die Zeitumstellung, bei der Einigkeit besteht, dass etwas geschehen muss, aber es nicht umgesetzt wird.
Intransparenz und Vermögenswerte der Kirchen
03:36:02Anders als Konzerne müssen Kirchen keine genauen Angaben über ihr Vermögen machen, da sie ihre inneren Angelegenheiten ohne staatliche Mitwirkung verwalten. Die Kirchen sind nicht zur Transparenz verpflichtet und wissen vermutlich selbst nicht, wie reich sie genau sind. Die meisten Bistümer und Landeskirchen veröffentlichen zwar Finanzberichte, aber diese sind oft nicht hilfreich, da jeder Rechtsträger seinen eigenen Haushalt macht und es keine konsolidierte Gesamtbilanz gibt. Yannick hat alle Bilanzen von Bistümern und Landeskirchen durchforstet und in Excel-Listen zusammengetragen. Wo Zahlen fehlten oder unklar waren, wurde nachgefragt, aber oft gab es keine oder nur kurze Antworten. Am Ende blieben viele Felder rot, was keine Auskunft bedeutet. Bei der katholischen Kirche sieht es nicht viel besser aus, da überall Werte fehlen, insbesondere das Vermögen der Caritas, Klöster und Pfarreien. Das Erzbistum Köln gibt an, dass es sich um eigenständige Körperschaften handelt und es nicht befugt sei, deren Vermögen zu veröffentlichen. Das Vermögen umfasst nicht nur Geld, sondern auch Kapitalerträge, Immobilien und Wertpapiere. Trotz etlicher Lücken kommen wir auf 44 Milliarden Euro für die katholische Kirche und 23 Milliarden für die evangelische Kirche, was zusammen rund 67 Milliarden Euro ergibt. Dies ist jedoch nicht das Gesamtvermögen, da viele Werte fehlen.
Immobilienbesitz und Kapitalanlagen der Kirche
03:42:11Zu den größten Vermögenswerten der Kirchen gehören Immobilien und Wertpapiere. Die Kirchen sind der größte Grundbesitzer Deutschlands mit einer geschätzten Fläche von 8.250 Quadratkilometern. Genaue Angaben zum Flächenbesitz machen die Kirchen nicht. In Berlin besitzen religiöse Gemeinschaften über 12 Quadratkilometer Land. Den Kirchen gehören nicht nur Grundstücke, sondern auch die Gebäude darauf, wie der Kölner Dom, der in der Bilanz mit einem Euro angegeben ist. Immobilien werden linear abgeschrieben, und nach der Abschreibungszeit beträgt der Bilanzschlusswert einen Euro. Die Kirchen betreiben zahlreiche Immobilienunternehmen zur Verwaltung und zum Bau von Wohngebäuden. Die ASW, die Aachener Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft, gehört mehreren Bistümern und verwaltet mehr als 26.000 Wohneinheiten. Sie wirbt mit sozialer Verantwortung, aber nur ein Drittel der Wohnungen sind öffentlich gefördert. Tochterunternehmen der ASW besitzen auch Luxusimmobilien in bester Lage. Die ASW ist keine gemeinnützige Organisation, sondern arbeitet profitorientiert und erzielte 2021 einen Jahresgewinn von 24,2 Millionen Euro. Kritiker bemängeln schlechte Instandhaltung und Mieterhöhungen, was die ASW zurückweist. Das Immobilienvermögen der Kirchen wird auf 50 Milliarden Euro geschätzt. Die Kirchen investieren auch in Aktien über professionelle Vermögensverwalter. Die Kirchen sind sehr verschwiegen, was ihre Kapitalanlagen betrifft. Sie haben Leitlinien für ihre Geldanlagen veröffentlicht, die ESG-Kriterien berücksichtigen, aber diese Leitlinien sind nicht verbindlich. Die katholische Kirche darf ihre Milliardeninvestitionen verschweigen, da die Vermögensverwaltung ein innerkirchlicher Bereich ist.