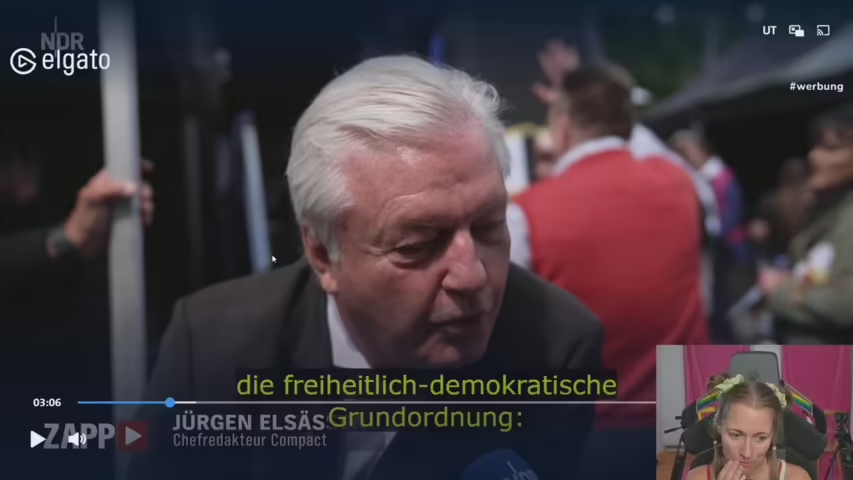Reaction auf Kein Land für Niemand mit !wer
Politik, Migration, Menschenrechte: Filmemacher analysieren 'Kein Land für Niemand'
Der Film 'Kein Land für Niemand' analysiert die europäische Migrationspolitik und die Situation von Geflüchteten. Filmemacher Max und Mike diskutieren über Push-Backs, Menschenrechtsverletzungen und die Rolle Deutschlands. Die Filmemacher beleuchten die komplexen Zusammenhänge zwischen Fluchtursachen, EU-Politik und der Rolle von Hilfsorganisationen. Ein dringender Appell zur Menschlichkeit.
Begrüßung und Stolz auf das eigene Studio
00:00:06Der Stream beginnt mit einer herzlichen Begrüßung und der Freude darüber, nach einer kurzen Pause wieder da zu sein. Es wird angekündigt, dass über die aktuelle Weltlage geplaudert und von den persönlichen Erlebnissen der letzten Tage berichtet wird. Besonders hervorgehoben wird der Stolz auf den Aufbau des eigenen Studios durch zwei Frauen, die sich technisch versiert gegenseitig ergänzen und alle Probleme selbstständig lösen konnten. Dieser Erfolg wird als 'fucking awesome' gefeiert, da kein externer Techniker benötigt wurde. Die Community finanziert das Projekt mit Resubs. Es wird die Manifestation des Studios und die Erstellung einer Checkliste dafür erwähnt. Der Einstand des Studios wird als 'absoluter Banger' bezeichnet, da das Thema des heutigen Streams sehr persönlich ist.
Update zur Stimme und Klimaveranstaltung
00:06:55Nach der Kaffeepause wird ein Update zum Zustand der Stimme gegeben, wobei betont wird, dass Anstrengungen unternommen werden, deutlich zu sprechen, aber weiterhin Probleme bestehen. Geplante Videoaufnahmen werden verschoben, um die Stimme zu schonen. Es wird die parasoziale Beziehung zur Community angesprochen und darauf hingewiesen, dass diese auch umgekehrt funktioniert. Es wird von einer enttäuschenden Klimaveranstaltung in Effheim mit Leo Mileni berichtet, bei der wenige Menschen anwesend waren. Mögliche Gründe dafür werden diskutiert, wie gutes Wetter und ein Festivalwochenende. Es wird über den Abschied vom Kater der Ex-Partnerin gesprochen und die Anteilnahme daran ausgedrückt.
Politische Diskussionen mit der Mutter und Stimmungsumfrage
00:10:18Es wird angekündigt, dass heute Politik gemacht wird und von politischen Diskussionen mit der Mutter berichtet, die überraschend gut informiert war und das G-Wort korrekt einordnen konnte. Uneinigkeiten gab es lediglich bei Migration. Es wird betont, wie stolz die Streamerin auf ihre Mutter ist und wie viel Spaß es gemacht hat, mit ihr über viele Dinge zu reden. Es wird erwähnt, dass bei Migration unterschiedliche Meinungen herrschen, bei Inklusion aber größere Einigkeit besteht. Eine Freundin wird erwartet, um nicht alleine zu sein. Bevor es in die politische Diskussion geht, wird eine Stimmungsumfrage unter den Zuschauern gestartet, um die allgemeine Stimmungslage zu erfassen. Es wird erwähnt, dass bis 13 Uhr Zeit ist und die Vorfreude darauf groß ist.
Inklusion, Kompakt-Magazin und Taz Artikel
00:14:57Die Diskussion dreht sich um Inklusion und die Frage, ob Menschen mit Behinderung in der Mitte der Gesellschaft stehen. Es wird kritisiert, dass es zu wenige Inklusionsprojekte gibt und Menschen mit Behinderung in der Leistungsgesellschaft schwer überleben können. Es wird erwähnt, dass Kuro im Urlaub ist und Bilder geschickt hat. Es wird betont, dass Menschen sagen dürfen, wenn Begrifflichkeiten für sie diskriminierend sind. Es folgt die Ankündigung, über das Kompakt-Magazin zu sprechen und eine dazugehörige Dokumentation zu schauen. Es wird gefragt, wer das Kompakt-Magazin kennt und ob es als problematisches Thema wahrgenommen wird. Ein Artikel in der Taz mit dem Titel 'Verzicht auf Dating, die Liebe, die ich habe' wird erwähnt, aber als nicht tagesaktuell und politisch relevant eingestuft.
Diskussion über 'Ungerechtes System' und Talkshow-Gäste
00:19:52Es wird überlegt, ob über das Thema 'Ungerechtes System' vom Spiegel diskutiert werden soll, obwohl Wolfgang Grupp als Gast dabei ist. Es wird vermutet, dass es wieder zu einer Konfrontation zwischen einer Frau und Wolfgang Grupp kommen wird. Christoph Ploss von der CDU ist ebenfalls anwesend. Es wird die Befürchtung geäußert, dass die Diskussion anstrengend werden könnte, aber dennoch interessant sein könnte, wenn Herr Feldenkirchen die Situation im Griff hat. Es wird beschlossen, mit diesem Thema zu beginnen, bevor zum Kompakt-Magazin übergegangen wird, da es im Moment am interessantesten erscheint. Es wird angemerkt, dass Herr Ploss selten in Talkshows zu sehen ist. Es wird sich gefragt, wie man sich an dem Ready Check beteiligen kann und erklärt, dass dies durch ein Emote möglich ist.
Steuerliche Wettbewerbsnachteile und Spendenstand
00:24:40Es wird ein Gespräch über Unternehmen und deren Standortwahl in Bezug auf Steuern geführt. Es wird argumentiert, dass Deutschland aufgrund höherer Steuern im Vergleich zu Polen einen Wettbewerbsnachteil hat. Es wird betont, dass Unternehmen Steuern zahlen müssen, um Bildung, Straßen, Schulen und Universitäten zu finanzieren. Es wird klargestellt, dass die Standortwahl von Unternehmen nicht nur von Steuern abhängt, sondern auch von öffentlichen Investitionen, schnellem Internet, Verlässlichkeit und Arbeitskräften. Der Spendenstand wird bewusst ausgeblendet, da die Spenden das ganze Jahr über für SOS Humanity gesammelt werden, der heutige Film jedoch in Zusammenarbeit mit CI und Sea-Watch entstanden ist. Es wird betont, dass die Seenotrettung unter United for Rescue betrachtet wird und Spenden weiterhin möglich sind.
Vorstellung der Talkshow-Gäste und Vermögensverteilung
00:26:54Es wird in die Talkshow 'ungleich' eingestiegen, in der es um die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich und faire Chancen geht. Die Gäste Janine Wissler (Die Linke), Wolfgang Grupp (Unternehmer) und Christoph Ploss (CDU) werden vorgestellt. Es wird eine Zahl genannt, die besagt, dass die reichsten 10 Prozent in Deutschland über 60 Prozent des Vermögens besitzen, während die ärmere Hälfte nur 3 Prozent besitzt. Es wird gefragt, ob das fair ist. Es wird angemerkt, dass Herr Grupp ein Millionär ist und Trigema kein Mittelstandsunternehmen. Es wird kritisiert, dass die reichsten 10 Prozent zwar die meisten Steuern zahlen, aber in Relation gesehen am wenigsten, da sie viele Möglichkeiten haben, Steuern zu umgehen.
Leistungsprinzip, Migration und AfD-Anfragen
00:31:15Es wird diskutiert, ob der Staat eine Verteilung vorgeben sollte, wobei betont wird, dass dies von der Leistung jedes Einzelnen abhängt. Es wird kritisiert, dass die Union suggeriert, jeder habe die Freiheit zu entscheiden, wer arm und wer reich ist, was aber unfair sei. Es wird argumentiert, dass das Leistungsprinzip dazu führt, dass Menschen, die nichts leisten können, Pech haben. Die Migrationsdebatte wird angesprochen und kritisiert, dass behauptet wird, Migranten würden nicht arbeiten. Es wird betont, dass Chancengerechtigkeit und Bildungsgerechtigkeit wichtig sind und in frühkindliche Bildung investiert werden muss. Es wird die AfD-Anfrage nach den häufigsten Vornamen von Bürgergeldempfängern thematisiert und die Ironie hervorgehoben, dass es sich um klassische deutsche Namen handelt.
Verantwortung und Haftung in der Wirtschaft
00:49:13Die Diskussion dreht sich um Verantwortung und Haftung, insbesondere für Geschäftsführer. Es wird kritisiert, dass einige Unternehmer Fehlentscheidungen treffen, Insolvenz anmelden und trotzdem ihr Vermögen behalten dürfen, während die Steuerzahler die Kosten tragen. Es wird gefordert, dass Geschäftsführer für ihre Fehler zur Rechenschaft gezogen werden und persönlich haften müssen, wenn sie ihre Firmen in den Ruin treiben. Die aktuelle Praxis wird als ungerecht empfunden, da sie dazu führt, dass erfolgreiche Unternehmer Gewinne einstreichen können, während die Allgemeinheit für Verluste aufkommt. Es wird betont, dass Politik hier handeln muss, um die Ursachen zu beheben und für mehr Gerechtigkeit zu sorgen. Es wird auch die Frage aufgeworfen, ob die CDU dieses Problem wirklich angehen will, da sie als unternehmensfreundliche Partei gilt und möglicherweise von den bestehenden Schlupflöchern profitiert.
Sozialer Frieden und Unternehmensverantwortung
00:52:11Es wird die Sorge geäußert, dass der soziale Frieden gefährdet sein könnte, und die Rolle der Unternehmer bei der Aufrechterhaltung dieses Friedens betont. Ein Unternehmer wird zitiert, der seine Mitarbeiter auffordert, ihn zu befragen, ob sie zufrieden sind. Es wird jedoch angemerkt, dass es wichtig ist, über die individuellen Qualitäten eines Unternehmers hinauszuschauen und systemische Probleme anzugehen. Die Frage der Vermögensverteilung wird aufgeworfen, und es wird kritisiert, dass einige Chefs sich hohe Gewinne auszahlen, während sie gleichzeitig niedrige Löhne zahlen. Es wird ein Beispiel für Unternehmen genannt, die eine Gehaltsobergrenze für ihre Chefs haben, die sich am Gehalt der niedrigsten Vollzeitangestellten orientiert. Es wird betont, dass politische Vorgaben wie ein höherer Mindestlohn, Tarifbindung und Arbeitsschutz notwendig sind, um faire Bedingungen zu schaffen, unabhängig davon, ob ein Unternehmen von einem "guten Menschen" geführt wird oder nicht.
Unternehmensbesteuerung und Wettbewerbsfähigkeit
00:57:00Die Diskussion dreht sich um die Körperschaftssteuer und die Frage, ob sie in Deutschland gesenkt werden sollte. Es wird argumentiert, dass Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen Ländern eine hohe Unternehmensbesteuerung hat, was zu einem Wettbewerbsnachteil führt. Einige befürchten, dass Unternehmen abwandern könnten, wenn die Steuern zu hoch sind. Andere halten dagegen, dass ein Steuerunterbietungswettbewerb vermieden werden sollte und dass Unternehmen, die von der Infrastruktur und anderen öffentlichen Gütern profitieren, einen angemessenen Beitrag leisten sollten. Es wird auch die Frage aufgeworfen, ob Steuererleichterungen tatsächlich zu Wirtschaftswachstum führen oder ob sie lediglich dazu führen, dass Wirtschaftsleistungen aus anderen Ländern abgezogen werden. Die Notwendigkeit globaler Unternehmenssteuern wird betont, um Steuervermeidung zu verhindern. Es wird kritisiert, dass die Regierungsparteien unterschiedliche Auffassungen zur Stromsteuersenkung haben und die Entlastungen hauptsächlich der Industrie und Landwirtschaft zugutekommen, anstatt den Verbrauchern.
Schuldenpolitik und Generationengerechtigkeit
01:12:15Die Diskussion dreht sich um die Schuldenpolitik der Regierung und die Frage, ob die geplanten Investitionen in Infrastruktur und Verteidigung gerechtfertigt sind. Ein Unternehmer betont, dass sein Unternehmen nie Schulden gemacht hat und dass Politiker für die Schulden der Regierung verantwortlich sind. Es wird die Frage aufgeworfen, ob die Schuldenbremse abgeschafft werden sollte, um Investitionen in wichtige Bereiche wie Wohnungsbau, Klimaschutz und Krankenhäuser zu ermöglichen. Es wird kritisiert, dass ein zu hoher Anteil des Bundeshaushalts für Rüstungsausgaben verwendet werden soll, während in anderen Bereichen wie Schulen und Verkehrsinfrastruktur Investitionen fehlen. Es wird betont, dass Investitionen über Kredite finanziert werden müssen, da sie nicht aus dem laufenden Haushalt bezahlt werden können. Es wird argumentiert, dass Generationengerechtigkeit nicht nur bedeutet, keine Schulden zu hinterlassen, sondern auch eine lebenswerte Welt zu erhalten und den Klimawandel zu bekämpfen. Die CDU wird kritisiert, eine ganze Generation für ihre Politik zu instrumentalisieren.
Insolvenzen, Vermögenssteuer und Gerechtigkeit
01:23:46Die Diskussion dreht sich um Insolvenzen, Vermögenssteuer und die wahrgenommene Ungleichbehandlung von kleinen und großen Unternehmen. Es wird kritisiert, dass große Unternehmen mit Milliardenkrediten Konkurs anmelden können, während kleine Unternehmen kämpfen müssen. Es wird die Frage aufgeworfen, ob eine Vermögenssteuer sinnvoll wäre, um die Vermögensverteilung zu korrigieren. Ein Unternehmer argumentiert gegen die Vermögenssteuer, da er der Meinung ist, dass diejenigen, die ein Vermögen geschaffen haben, bereits Steuern bezahlt haben und nicht nochmals zur Kasse gebeten werden sollten. Es wird jedoch entgegnet, dass viele große Vermögen durch Ausbeutung oder schlechte Bezahlung von Mitarbeitern entstanden sind. Es wird betont, dass die Vermögenssteuer nur einen kleinen Teil der Bevölkerung mit einem Vermögen von über einer Million Euro betreffen würde. Die Aussage, dass die Vermögenssteuer eine Substanzbesteuerung sei, wird als pauschal und falsch kritisiert, da sie in der Praxis einen Teil der Zugewinne besteuern würde.
Vermögenssteuerdebatte und Kritik an Unternehmensbesteuerung
01:32:47Die Diskussion dreht sich um die Vermögenssteuer und deren Auswirkungen auf Unternehmen, insbesondere Stahlkonzerne. Es wird argumentiert, dass eine Vermögenssteuer die Stahlindustrie, die bereits mit Problemen auf dem Weltmarkt zu kämpfen hat, zusätzlich belasten würde. Stattdessen wird eine Kritik an der hohen Unternehmensbesteuerung in Deutschland geäußert und eine Ausgabenkritik gefordert. Ein CDU-Vertreter kritisiert, dass immer wieder über weitere Unternehmensbesteuerungen diskutiert wird, anstatt die Regierung für ihre Verantwortung bei der Gestaltung der Transformation und Investitionen in Bereiche wie den Industriestrompreis zu kritisieren. Es wird auch die Frage aufgeworfen, wie schnell man eine Million Euro erreichen kann, wobei Beispiele von Immobilienkäufen und Landwirtschaft genannt werden. Dies wird jedoch als realitätsfern abgetan, da es sich um die oberen 5% der Bevölkerung handelt.
Vermögenssteuer, Bürokratie und Steuergerechtigkeit
01:36:04Die Diskussionsteilnehmer äußern sich zur Vermögenssteuer und deren potenziellen Auswirkungen auf die Verlagerung von Unternehmen ins Ausland. Ein Unternehmer betont seine Verpflichtung gegenüber seinem Heimatland und seinen Mitarbeitern und argumentiert, dass eine Verlagerung des Betriebs nicht so einfach sei. Es wird auch die Bürokratie kritisiert, die mit der Erfassung von Vermögen einhergehen würde. Es wird argumentiert, dass Deutschland bereits genug Länder habe, die Vermögen besteuern, und dass der Anteil vermögensbezogener Steuern am deutschen Steuerkuchen gering sei. Im Gegensatz dazu wird kritisiert, dass Arbeit in Deutschland stärker besteuert werde als Vermögen und Kapital. Es wird ein Vergleich gezogen zwischen dem bürokratischen Aufwand bei der Schikanierung von Bürgergeldempfängern und dem weniger genauen Hinsehen bei Vermögenden. Abschließend wird die Notwendigkeit einer Entlastung für Arbeitnehmer, insbesondere Pflegekräfte, betont.
Bürgergelddebatte und Kritik an der Behandlung von Leistungsempfängern
01:41:51Die Diskussionsteilnehmer erörtern die Ausgaben für das Bürgergeld und die Notwendigkeit, die Verwendung der Steuergelder zu kontrollieren. Es wird kritisiert, dass bei der Kontrolle von Bürgergeldempfängern genauer hingesehen werde als bei der Steuerpflicht von Vermögenden. Es wird auf Steuerhinterziehung in dreistelliger Milliardenhöhe hingewiesen, die im Vergleich zu den Ausgaben für Bürgergeldempfänger gering erscheinen. Ein Teilnehmer berichtet von einem Unternehmer, der Ärzte seiner krankgeschriebenen Mitarbeiter kontaktiert, um diese zu kritisieren. Es wird die Höhe des Bürgergelds von 563 Euro pro Monat diskutiert und die Frage aufgeworfen, ob dies zu viel sei. Ein Teilnehmer kritisiert den Begriff Bürgergeld und plädiert dafür, dass Arbeitslose Arbeitslosengeld erhalten sollten. Es wird auf schlechte Bewertungen von Trigema als Arbeitgeber hingewiesen und die Arbeitsbedingungen kritisiert. Ein Ex-Trigema-Chef wird dafür kritisiert, Ärzte für hohe Krankheitsstände verantwortlich zu machen und vorzuschlagen, Arbeitnehmern im Krankheitsfall nur 80 Prozent ihres Gehalts zu zahlen.
Kritik an Bürgergeld und Arbeitsbedingungen, Diskussion über Migration und Renten
01:50:58Die Diskussionsteilnehmer äußern sich kritisch über die Umformulierung von Arbeitslosengeld in Bürgergeld und die Vorstellung, dass junge Menschen Bürgergeldempfänger werden wollen. Es wird betont, dass Bürgergeld das Minimum zum Leben sein müsse und dass Arbeitslose jede angebotene Arbeit annehmen sollten. Es wird kritisiert, dass Näherinnen länger arbeiten wollen, weil sie nicht ordentlich bezahlt werden. Die Diskussionsteilnehmer erörtern die Frage, ob 563 Euro im Monat für Bürgergeld zu viel seien und ob dies einen Anreiz zur Arbeitsaufnahme fehle. Es wird betont, dass viele Bürgergeldbezieher arbeiten, aber aufstockende Leistungen erhalten. Die Diskussionsteilnehmer sprechen sich für eine Abschaffung des Bürgergelds und eine Verschärfung der Sanktionen aus. Es wird betont, dass jemand, der unverschuldet in Not geraten ist, unterstützt werden müsse, aber dass es auch eine größere Zahl von Menschen gebe, die erwerbsfähig seien, sich aber verweigerten. Es wird kritisiert, dass über Peanuts diskutiert werde, anstatt über Steuerhinterziehungen von Unternehmen. Abschließend wird die Notwendigkeit von Migration zur Sicherung der Rentenkassen betont.
Demografischer Wandel, Migration und innere Konflikte
02:17:08Es wird die These aufgestellt, dass Migration eine Lösung für den demografischen Wandel in Deutschland sein könnte, jedoch die Politik Menschengruppen gegeneinander ausspielt, wodurch Migranten als Feindbild wahrgenommen werden. Es wird kritisiert, dass selbst in der aktuellen Diskussion Syrer als Feindbild dienten, obwohl diese Bevölkerungsgruppe überdurchschnittlich oft einer Beschäftigung nachgeht. Es folgt ein Übergang zu einem anderen Thema, wobei sich für 18 Monate bedankt wird. Die Streamerin betont, dass eine Reichensteuer bereits viel bewirken könnte und empfiehlt, linke Parteien zu wählen, sofern man nicht Millionär ist. Abschließend wird festgestellt, dass es menschlich sei, sich besser zu fühlen, wenn es anderen schlechter geht, was jedoch viel mit Erziehung und gesellschaftlichen Strukturen zu tun habe. Der Kapitalismus funktioniere so, und man müsse aufpassen, nicht als Migrationsleugner bezeichnet zu werden, wenn man solche Standpunkte vertritt.
Diskussion über Rentnerarbeit und Umgang mit älteren Arbeitnehmern
02:20:05Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Rentner weiterhin arbeiten sollten und wie Unternehmen mit älteren Arbeitnehmern umgehen. Es wird hervorgehoben, dass Rentner, die arbeiten möchten, dies auch tun können, aber niemand dazu verpflichtet werden sollte, insbesondere nach langer Erwerbstätigkeit. Es wird auf Bewertungen auf der Plattform KUNU hingewiesen, die einen schlechten Umgang mit älteren Arbeitnehmern in einem bestimmten Unternehmen nahelegen. Die Streamerin äußert Zweifel an der Glaubwürdigkeit von Aussagen bezüglich der Unterstützung älterer Arbeitnehmer, insbesondere im Kontext von Berichten über kritische Briefe an Ärzte, die Krankmeldungen ausstellen. Abschließend wird betont, dass die Politik freiwillige Arbeit im Rentenalter unterstützen sollte, da es wichtig sei, sich gebraucht zu fühlen.
Auseinandersetzung mit dem Begriff 'Migrationsleugner' und Kritik an Cicero
02:23:02Es wird der Begriff 'Migrationsleugner' im Kontext einer früheren Kontroverse um die Grünen und deren vermeintlich unrealistischen Blick auf die Probleme der Migration diskutiert. Die Streamerin betont, dass sich der Fokus mittlerweile stärker auf die Linken verlagert habe, da diese als stärkere Oppositionspartei wahrgenommen würden. Sie erwähnt eine Klage von Cicero gegen Drakon und distanziert sich von Cicero-Artikeln, da diese ihrer Meinung nach sehr weit rechts außen angesiedelt seien. Die Streamerin berichtet von einer Entschuldigung eines ehemaligen Kritikers über Instagram und betont ihre Fähigkeit, negative Kommentare über sich selbst zu ignorieren. Sie erwähnt einen Vorfall, bei dem KuchenTwizy sich für ein Video entschuldigt habe, dessen Inhalt ihr jedoch unbekannt sei. Abschließend wird festgestellt, dass Cicero ein anderes Niveau darstelle und man sich bei Verleumdungen in dieser Zeitschrift Gedanken machen sollte.
Kritik an Talkshow-Diskussionen und Forderung nach armutsfesten Renten
02:30:52Es wird kritisiert, dass in Talkshows oft keine konstruktive Diskussion möglich ist, da Gesprächsteilnehmer ständig unterbrochen werden und der Moderator nicht eingreift. Im Zentrum steht die Frage, ab wann Menschen abschlagsfrei in Rente gehen können, wobei betont wird, dass viele Menschen, insbesondere in körperlich anstrengenden Berufen, das reguläre Renteneintrittsalter gar nicht erreichen. Es wird gefordert, dass niemand im Alter arbeiten gehen muss, weil die Rente nicht zum Leben reicht. Die Streamerin kritisiert, dass diese Forderung nach armutsfesten Renten von einem Milliardär und einem Unionspolitiker in der Diskussion ständig unterbrochen wird. Abschließend wird die Realitätsferne von Herrn Grupp kritisiert, insbesondere in Bezug auf Scheidungsunterhalt und die Lebensrealität vieler Menschen. Es wird betont, dass der Staat Menschen unterstützen muss, die unverschuldet in Not geraten sind.
Abschlussdiskussion über Gerechtigkeit, Steuerreform und Verteilung des Reichtums
02:39:36Die Abschlussdiskussion dreht sich um die Frage, ob Deutschland gerechter werden muss. Während ein Teilnehmer Chancengerechtigkeit und Generationengerechtigkeit betont und weitere Steuererhöhungen ablehnt, fordert eine andere Teilnehmerin eine große Steuerreform, die Vermögen stärker besteuert und niedrige Einkommen entlastet. Es wird kritisiert, dass der erarbeitete Reichtum ungerecht verteilt ist und sich eine kleine Minderheit ein großes Stück vom Kuchen sichert. Die Streamerin freut sich auf einen Döner zur Belohnung und betont, dass die Politik für Gerechtigkeit sorgen muss, da Ungerechtigkeit zu Dissens führt. Abschließend wird betont, dass die Unterstützung von Menschen in Not wichtig ist, aber auch die Anständigkeit nicht zu kurz kommen darf.
Ankündigung weiterer Inhalte und Diskussion über Rechtsextremismus
02:44:24Es werden weitere Inhalte angekündigt, darunter eine Doku des NDR über das rechtsextreme Kompakt-Magazin, dessen Verbot vor Gericht gescheitert ist. Die Streamerin betont, dass dieses Thema bisher stiefmütterlich behandelt wurde und dringend aufgearbeitet werden muss. Sie bittet die Zuschauer, ihr ein Video der Heute-Show zu schicken, da sie diese Sendung selten schaut. Es wird klargestellt, dass die Zuschauer das diskutierte Video vorgeschlagen haben und nicht die Streamerin selbst. Abschließend wird angekündigt, sich nach dem Stream einen Döner zu gönnen und eventuell tanzen zu gehen. Es wird betont, dass man keinen Döner teilt und dass die Streamerin hart daran gearbeitet hat, teilen zu lernen.
Analyse der Entscheidung zum Kompakt-Magazin und Diskussion über Pressefreiheit
02:50:33Die Streamerin kommentiert die Gerichtsentscheidung, die das Verbot des rechtsextremen Kompakt-Magazins aufhebt, und antizipiert Reaktionen, die dies als Erfolg für die Rechte sehen könnten. Sie betont, dass ein Verbot anzustreben dennoch wichtig sei, auch im Fall der AfD. Es wird ein Bericht über den Kompakt-Chef Jürgen Elsässer und seine Reaktion auf die Entscheidung zitiert, der von einem Angriff auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung spricht. Die Streamerin betont die Stärke der Demokratie, auch wenn sie kritisiert wird, zieht aber eine Grenze bei Parteien wie der AfD, die ihrer Meinung nach verboten werden sollte. Abschließend wird die Rolle von Kompakt als Vernetzer der rechtsextremen Szene und seine Verbindungen zur AfD beleuchtet.
Diskussion über den Umgang mit rechtsextremen Zeitschriften im Einzelhandel
03:00:19Es wird die Frage aufgeworfen, wie mit rechtsextremen Zeitschriften im Einzelhandel umgegangen werden soll. Die Streamerin kritisiert, dass diese Zeitschriften oft neben renommierten Publikationen verkauft werden und dies als Normalität behandelt wird. Sie betont, dass es zwar Ausnahmen gibt, aber viele Kioskbesitzer diese Zeitschriften wie jeden anderen Journalismus behandeln, was sie für einen Fehler hält. Es wird diskutiert, ob Kioskbesitzer die Möglichkeit haben, selbst zu entscheiden, welche Zeitschriften sie anbieten, und ob sie durch Bundles dazu gezwungen werden, auch unerwünschte Titel zu verkaufen. Die Streamerin räumt eine Wissenslücke ein und bittet die Zuschauer um Aufklärung.
Analyse der Kompakt-Strategie und Ziele
03:06:28Es wird die Frage aufgeworfen, ob 'Kompakt' rechtspopulistische Inhalte aus wirtschaftlichem Druck verbreitet. Die Aussagen von Elsässer und seinen Autoren deuten auf verfassungsfeindliche Ziele hin, wie die Verwendung von Begriffen wie 'Passdeutsche' und 'Migrationswaffe'. Ein abgefischtes Zoom-Meeting aus dem Jahr 2022 zeigt, wie Jürgen und Stefanie Elsässer mit anderen über ein mögliches Ende des politischen Systems diskutieren und an einer Machtperspektive arbeiten wollen, notfalls durch eine Querfront. Elsässer betont die Bedeutung der 'einfachen Leute' unter den 40.000 Käufern des Magazins für ihre Revolution. Weiterhin werden rassistische Äußerungen Elsässers gegenüber Grünen-Chef Omid Nouripour zitiert, sowie die Vorstellung einer 'Umvolkung zur Mischrasse'. Seit 2021 gilt 'Kompakt' als gesichert extremistisch und wird vom Verfassungsschutz beobachtet. Trotzdem nutzt das Magazin den Prozess als Bühne, wobei das Medieninteresse groß ist und das Ehepaar Elsässer selbstbewusste Statements abgibt.
Gerichtliche Auseinandersetzung um das Verbot von 'Kompakt'
03:11:13Der Streamer beleuchtet die juristischen Aspekte des Verbotsverfahrens gegen 'Kompakt'. Es wird betont, dass Verbote von Presseorganen in Deutschland unüblich sind, aber das Vereinsverbot eine Rolle spielt. Das Gericht deutet an, dass das Vereinsgesetz auf 'Kompakt' anwendbar sein könnte, da Vereine, die sich gegen die Verfassung richten, verboten werden können, selbst wenn sie Nachrichten und Meinungen verbreiten. Das Bundesinnenministerium hat in der Vergangenheit bereits Mediengesellschaften über das Vereinsgesetz verboten, darunter die türkische Tageszeitung 'Anadolu Davakit' und das Neonazi-Nachrichtenportal 'Alta Media'. Die Hürden für ein Verbot über das Vereinsrecht sind jedoch hoch; 'Kompakt' muss nicht nur verfassungsfeindliche Inhalte publizieren, sondern auch kämpferisch aggressiv auftreten und einen Gesamtplan verfolgen, der auf einen Umsturz abzielt. Vor Gericht wird diskutiert, inwiefern 'Kompakt' ein reines Medienunternehmen ist und wie die Pressefreiheit bei einem Vereinsverbot zu berücksichtigen ist. Ein Beleg des Bundesinnenministeriums ist eine Spendengala 2023, auf der Elsässer sagte, man wolle das Regime stürzen.
Verhandlungstag zwei und die Argumentation der Parteien
03:16:15Am zweiten Verhandlungstag werden die vorgelegten Beweise diskutiert. Das Bundesinnenministerium zeigt einen Artikel von Jürgen Elsässer, in dem er behauptet, die Regierung verfolge mit der Migrationspolitik den Plan, das deutsche Volk zu vermischen. Der Anwalt des Ministeriums argumentiert, dass 'Kompakt' einen rassistisch-ethnischen Volksbegriff vertritt und Menschen mit Migrationshintergrund keine Chance hätten, dazuzugehören, was gegen die Menschenwürde verstoße. Die Anwälte von 'Kompakt' entgegnen, dass es keine Beweise dafür gebe, dass 'Kompakt' Deutsche mit Migrationshintergrund entrechten wolle. Ein Zitat des österreichischen Rechtsextremisten Martin Sellner, der regelmäßig für 'Kompakt' schreibt und eine millionenfache Rückführung fordert, wird diskutiert. Elsässer schätzt Sellner als Autor, distanziert sich aber nicht öffentlich von seinen Ansichten, was ihm vom Anwalt des Bundesinnenministeriums vorgeworfen wird. Der Kompaktanwalt sieht darin kein Problem, da das Publikum so die Möglichkeit habe, sich authentisch über Sellners Position zu informieren.
Urteilsverkündung und Reaktionen
03:20:39Das Gericht stellt fest, dass 'Kompakt' kein reines Medienunternehmen ist, sondern eine politische Agenda mit verfassungsfeindlichen Inhalten verfolgt, die teilweise die Menschenwürde verletzen. Das Konzept von Martin Sellner wird 'Kompakt' zugerechnet, da sie von einer zu bewahrenden ethno-kulturellen Identität ausgehen und deutsche Staatsangehörige mit Migrationshintergrund als Bürger zweiter Klasse behandeln. Da das Gericht jede Äußerung wohlwollend interpretieren muss, reichen die Belege für ein Verbot nicht aus. Für Elsässer und sein Team ist die Entscheidung die beste Werbung, die sie haben könnten. Das Bundesinnenministerium erleidet eine Niederlage, da das Verbot rechtswidrig war. Elsässer kostet den Moment aus und sieht 'Kompakt' als stärkste Stimme der Opposition. Reporter ohne Grenzen und der Deutsche Journalistenverband begrüßen die Entscheidung im Sinne der Meinungs- und Pressefreiheit, verweisen aber auf die menschenfeindlichen Inhalte von 'Kompakt'. Das Bundesinnenministerium gibt kein Interview ab, Innenminister Alexander Dobrindt äußert sich knapp und betont, dass die Pressefreiheit auch rechtsextreme Inhalte toleriert.
Diskussion über Elon Musk, J.D. Vance und die US-Politik
03:27:36Es wird über die mögliche Parteigründung von Elon Musk diskutiert und welche Gründe er dafür haben könnte. Entscheidend für die Einordnung wären die Reaktionen von Peter Thiel, J.D. Vance und Trump. Es wird spekuliert, ob Musk sich als Präsidentschaftskandidat trauen würde, wobei J.D. Vance als möglicher Kandidat in den Startlöchern gesehen wird. Musk ist nicht in den USA geboren und kann daher nicht Präsident werden. J.D. Vance wird als derjenige aufgebaut, der für Peter Thiel gegen Trump antritt und als viel extremer als Donald Trump eingeschätzt. Vance war ursprünglich gegen Trump, aber Peter Thiel hat sie zusammengebracht. Es wird vermutet, dass Vance Trump immer noch nicht mag. Es wird die Frage aufgeworfen, warum J.D. Vance als Faschist bezeichnet wird und angedeutet, dass dies kein Geheimnis sei. Abschließend wird auf die morgige Sendung verwiesen, in der die USA News und die Entwicklungen um Trump und Elon Musk genauer betrachtet werden sollen.
Analyse des Erfolgs rechter Parteien und Kritik am Neoliberalismus
03:34:28Es wird analysiert, warum rechte Parteien in westlichen Demokratien so erfolgreich sind. Der Grund liegt darin, dass viele Menschen wütend sind und sich verarscht fühlen. Rechte Parteien sprechen diese Gefühle an, bieten aber keine echten Lösungen, sondern lenken von den eigentlichen Problemen ab. Stattdessen machen sie Geflüchtete oder andere Minderheiten für die Missstände verantwortlich. Die Ursache für die Wut liegt in der ungerechten Verteilung von Wohlstand und den Auswirkungen des Neoliberalismus. Seit den 80er Jahren haben Ronald Reagan und Margaret Thatcher einen starken Sozialstaat abgebaut und die Abstände zwischen Arm und Reich vergrößert. Der Neoliberalismus hat dazu geführt, dass staatliche Leistungen gekürzt, Schulen nicht renoviert und Leiharbeitsfirmen gegründet wurden. Das System funktioniert nur, solange immer neue Leute gefunden werden, die sich ausbeuten lassen. Die Bankenkrise 2008 und die Klimakrise haben gezeigt, dass das kurzfristige Gewinnstreben eine schlechte Idee war. Rechte Parteien nutzen diese Wut aus, um ihre eigenen Ziele zu verfolgen.
Forderungen nach einer fairen Gesellschaft und Vermögenssteuer
03:50:06Es wird gefordert, dass die Menschen aufhören, sich verarschen zu lassen und stattdessen an einer fairen Gesellschaft arbeiten. Konkret werden zwei Ideen genannt: eine Vermögenssteuer und eine Erbschaftssteuer. In Deutschland besitzt das reichste Prozent der Menschen ein Drittel des Vermögens, von dem jährlich ein oder zwei Prozent an den Staat abgeführt werden sollten. Auch eine Erbschaftssteuer sei notwendig, wobei kleine Vermögen nicht betroffen wären. Stattdessen müssten die großen Vermögen, wie beispielsweise bei BMW, stärker besteuert werden. Abschließend wird betont, dass es ein 'Wir' gegen die da draußen gibt, wobei dieses 'Wir' jede Person umfasst, die mindestens so viel in die Welt und in das System reinsteckt, wie sie rauskriegt.
Abschluss der Vorbereitungen und Technik-Check für den Livestream
03:51:35Der Streamer beendet die Vorbereitungen und kündigt an, dass Jeff Bezos enteignet wird. Es folgt ein Technik-Check, um sicherzustellen, dass alle Mikrofone einwandfrei funktionieren. Die Community wird um Feedback gebeten, indem sie ein 'Plus' in den Chat schreiben sollen, wenn das jeweilige Mikrofon funktioniert. Der neue Mikrofonarm mit Pride-Flags wird kurz gezeigt. Es wird bestätigt, dass die Regie (Dori) alles testet und vorbereitet. Unter dem Tisch befindet sich ein Fußpedal, mit dem der Film während der Reaction gestartet und gestoppt werden kann. Die Technik wird als 'fucking brilliant' bezeichnet. Es wird sichergestellt, dass der Ton des zweiten und dritten Bildschirms (Fernseher) funktioniert. Das Studio wird kurz vorgestellt, inklusive des lila Moderationsstuhls.
Ankündigung des exklusiven Filmausschnitts und der Gäste
03:54:55Die Vorfreude auf die Gäste, die Filmemacher von 'Kein Land für Niemand', wird betont. Es wird angekündigt, dass exklusiv 15 Minuten aus dem Film gezeigt werden dürfen, obwohl der Film noch in den Kinos läuft. Es wird eine Stunde Interview und gemeinsame Filmansicht mit den Filmemachern Max und Mike geben. Die Kooperation mit CI, Sea-Watch und United for Rescue wird hervorgehoben, da der Film Themen wie Migration, Politik und Menschen auf der Flucht behandelt. Der Streamer betont, dass der Film wichtig für Politiker sei und fordert die Zuschauer auf, ihn ihren Abgeordneten zu schicken. Der Link zum Film und zu den Filmemachern wird unter dem Command '!wer' zu finden sein.
Technik-Test mit den Gästen und Begrüßung der Zuschauer
04:01:20Ein Technik-Test mit den Gästen Mike und Max wird durchgeführt. Die Zuschauer werden begrüßt und darauf hingewiesen, dass der Stream auch später auf YouTube verfügbar sein wird. Es wird angekündigt, dass exklusiv 15 Minuten aus dem Film 'Kein Land für Niemand' gezeigt werden, und der Link zum vollständigen Film in der Videobeschreibung oder über den Command '!wer' zu finden ist. Die Gäste werden mit einer kleinen Fragerunde ins Gespräch eingeführt, um sie und ihre Arbeit dem Publikum näherzubringen. Die erste Frage dreht sich um die Kreation eines neuen Feiertags und dessen Bedeutung, woraufhin die Filmemacher einen 'Geflüchteten-Tag' mit Migrations-Debatten-Kultur vorschlagen. Die zweite Frage thematisiert eine Reise in die Vergangenheit oder Zukunft, um eine wichtige Lektion zu lernen, woraufhin einer der Filmemacher den Tag seiner Geburt wählt, um die Umstände seiner Ankunft in der Welt besser zu verstehen.
Entstehung des Films 'Kein Land für Niemand' und die Motivation der Filmemacher
04:05:37Die Filmemacher Max und Mike erzählen, dass sie sich seit 2014 kennen und bereits mehrere Filmprojekte zusammen realisiert haben. Mikes Erfahrungen auf einer Seenotrettungsmission im Mittelmeer im Jahr 2016, wo er einen Dokumentarfilm drehte, waren prägend. Die beiden diskutierten intensiv über die sich verschärfende Lage für Geflüchtete in Europa und Deutschland und beschlossen 2022, einen Film zu machen, der nicht nur die Situation an den Außengrenzen dokumentiert, sondern auch die EU- und deutsche Politik beleuchtet. Sie hatten das Gefühl, dass im Journalismus oft der Zusammenhang fehlt und wollten ein umfassendes Panorama schaffen. Der Film soll die Frage aufwerfen, was die deutsche Gesellschaft mit der Situation an den Außengrenzen zu tun hat und die Rolle deutscher NGOs wie Sea-Watch hervorheben. Gedreht wurde über dreieinhalb Jahre, wobei viele Menschen im Asylprozess begleitet wurden, darunter Tarek von Pro Asyl und Erik Marquardt von den Grünen.
Reaktion auf Filmausschnitte und Diskussion über die Situation im Mittelmeer
04:13:06Es werden Filmausschnitte gezeigt, die die brutalen Pushbacks der libyschen Küstenwache gegen Flüchtlinge dokumentieren, welche mit EU-Geldern finanziert wird. Die Filmemacher erläutern, dass die gezeigte Szene etwa nach 15 Minuten im Film kommt und das Ausmaß der Katastrophe verdeutlichen soll. Es wird betont, dass viele Menschen im Mittelmeer vermisst werden (über 32.000 seit 2014), was bedeutet, dass sie wahrscheinlich tot sind. Die Filmemacher und der Streamer diskutieren darüber, wie sich die Situation im Mittelmeer verändert hat, da die italienische Küstenwache nicht mehr hilft und stattdessen die libysche Küstenwache eingesetzt wird, um Menschen abzufangen. Es wird ein Fall einer schwangeren Frau geschildert, die auf einer CI-Mission nicht rechtzeitig evakuiert wurde und ihr Kind verlor. Sie kritisieren, dass solche Geschichten keinen Nachrichtenwert mehr haben, obwohl sie emotional aufwühlend sind. Die politische Debatte habe sich so gedreht, dass das Leben dieser Menschen in Deutschland für viele nichts mehr wert sei.
Diskussion über Migrationspolitik und den Umgang mit Geflüchteten in Deutschland
04:23:05Es wird über die Migrationspolitik in Deutschland diskutiert, wobei Aussagen von Politikern gezeigt werden, die eine Reduzierung der Flüchtlingszahlen fordern. Die Filmemacher und der Streamer thematisieren die Rolle von Julia Roos, die im öffentlich-rechtlichen Fernsehen eine Sendung zum Thema Migration hat und kritisiert wird, weil sie rechten Positionen eine Plattform bietet. Es wird betont, dass sich die Willkommenskultur in Deutschland seit 2015 verändert hat und dass neue Gesetze das Ankommen und die Teilhabe von Geflüchteten erschweren. Instrumente wie die Bezahlkarte und das Rückführungsverbesserungsgesetz werden als Beispiele genannt. Die Filmemacher erläutern, dass es im Asylbewerberleistungsgesetz eine Arbeitspflicht gibt, die es erlaubt, Asylsuchende zu gemeinnütziger Tätigkeit für 80 Cent pro Stunde zu verpflichten. Sie kritisieren, dass dies zu Zwangsarbeit und Ausbeutung führt und dass die Menschen dadurch keine Qualifikationen erwerben, die ihnen eine bessere Perspektive ermöglichen.
Politische Entwicklungen und das Engagement für Geflüchtete
04:37:27Die politischen Ereignisse der letzten drei Monate im Bereich Flucht und Migration werden angesprochen, wobei der Fokus auf Verschärfungen liegt. Tarek von Pro Asyl wird zitiert, der seine Verantwortung betont, den Rechtsruck zu verhindern. Die Filmemacher diskutieren über die Auswirkungen dieser Entwicklungen auf Menschen wie Tarek und Erik Marquardt, die sich für die Rechte von Geflüchteten einsetzen. Sie betonen, dass diese Arbeit sehr anstrengend ist und dass die Betroffenen Angst haben müssen, dass ihnen die Mittel entzogen werden. Es wird hervorgehoben, dass ein fremdenfeindliches Klima geschaffen wird, das alle Menschen trifft, die ausländisch gelesen werden können. Trotz der schwierigen Situation bleibt den Aktivisten nichts anderes übrig, als weiterzukämpfen, um sich später nicht vorwerfen zu müssen, nicht genug getan zu haben.
Migrationspolitik und ihre Auswirkungen
04:41:06Die Diskussion über Migrationspolitik beleuchtet die Notwendigkeit, Geflüchtetenpolitik und Fachkräftezuwanderung zusammenzudenken. Es wird kritisiert, dass eine restriktive Geflüchtetenpolitik und das Schüren von Fremdenhass negative Auswirkungen haben, was eine Studie des IAB belegt, die zeigt, dass 25 Prozent der Menschen mit Migrationsgeschichte die Auswanderung aus Deutschland erwägen. Dies betrifft vor allem gut ausgebildete Fachkräfte, die sich andere Länder suchen. Es wird die Frage aufgeworfen, warum demokratische Parteien im Wahlkampf nicht offensiver Migration als Chance für Deutschland dargestellt haben, da jährlich 400.000 Menschen benötigt werden. Stattdessen liefen sie den Narrativen von Rechts hinterher, was den demokratischen Parteien bei den Wahlergebnissen schadete. Die Union, obwohl mit schlechten Umfragewerten, fährt diese Schiene weiter, was unverständlich ist, da Beratungsteams im Hintergrund von diesem Kurs abraten. Es wird vermutet, dass die SPD möglicherweise eine rechte Partei ist, deren Seeheimer Kreis eine enorme Macht ausübt und migrationsfeindliche Positionen vertritt, was im Widerspruch zur Basis steht. Abschließend wird die Einführung einer Bezahlkarte für Flüchtlinge als Ende dieses Abschnitts betrachtet.
Pull-Faktoren und Sozialleistungen in der Migrationsdebatte
04:48:12Es wird diskutiert, ob wirtschaftliche Anreize und Sozialleistungen einen Pull-Faktor für Migration darstellen. Kritisiert wird die Erzählung, dass unser Sozialstaat ein Pull-Faktor sei und Leistungen schlecht ausgestaltet sein müssten. Es wird argumentiert, dass es keinen Beleg dafür gibt, dass Sozialleistungen einen Pull-Faktor darstellen, und diese Push-Pull-Argumentation hauptsächlich im politischen Raum Bedeutung hat, während sie im wissenschaftlichen Raum kaum eine Rolle spielt. Die Idee eines rationalen Menschen, der sein Leben riskiert, um von besseren Sozialleistungen zu profitieren, wird als unrealistisch dargestellt. Es wird gefordert, medial gegen diese Vorstellung anzukämpfen, da das Pull-Faktor-Argument von Social Media bis in die Spitzenpolitik kommuniziert wurde, obwohl es widerlegt ist. Der Journalismus wird kritisiert, solche Aussagen unkritisch in Headlines zu übernehmen. Es wird ein Live-Fakten-Check in Talksendungen gefordert, um Falschinformationen direkt zu widerlegen. Die Kommunen sehen sich mit hohen Emotionen und kaum Lösungen konfrontiert, was zu einer permanenten Aufregung führt. Es wird betont, dass die Kommunensituation rückläufig ist und Flüchtlingsheime eher abgebaut als aufgebaut werden. Das Argument der überlasteten Kommunen wird als nicht haltbar kritisiert, da Kapazitäten vorhanden wären, es jedoch an konstruktiven Diskussionen zur besseren Verteilung mangelt. Die Politik fährt auf Sicht und veranstaltet Migrationsgipfel, um den starken Mann zu markieren, anstatt die Kosten vom Bund übernehmen zu lassen.
Falsche Narrative und Realität der Migration
04:59:05Es wird kritisiert, dass fälschlicherweise behauptet wird, viele aus humanitären Gründen aufgenommene Flüchtlinge hätten keine Arbeit und lebten von Sozialleistungen. Dem wird entgegnet, dass die meisten Männer mit Fluchthintergrund nach acht Jahren statistisch häufiger in Arbeit sind als die durchschnittliche Bevölkerung in Deutschland. Zugewanderte bringen dem Sozialstaat im Schnitt 7500 Euro pro Jahr, was etwa 100 Milliarden Euro jährlich entspricht. Diese Zahlen werden in der medialen Debatte jedoch nicht berücksichtigt. Es wird argumentiert, dass es zu lange dauert, diese komplexen Zusammenhänge zu erklären, was Rechtspopulismus begünstigt. Erik Markwalds Forderung, Migration weniger aufzuregen, wird aufgegriffen. Stattdessen würden die Leute, die das Thema ins Rampenlicht ziehen, versuchen, politischen Gewinn daraus zu ziehen. Die Flüchtlingskonvention und die Europäische Menschenrechtskonvention werden in Frage gestellt. Vor einer Spaltung durch die Migrationsdiskussion wird gewarnt. Die deutsche Gesellschaft sei weniger gespalten, als die Schlagzeilen der Medien vermuten lassen. Es wird kritisiert, dass die Aussagen der letzten Jahre, wie die von Merz über Zahnarzttermine, medial aufgebauscht und schnell wieder vergessen werden. Der Film wird als Zeitzeugnis verstanden, das die Entwicklung von 2015 bis 2024 dokumentiert.
Europäische Außengrenzen und Menschenrechtsverletzungen
05:12:44Es wird auf die Situation an den europäischen Außengrenzen aufmerksam gemacht, wo Schutzsuchende mit Gewalt zurückgeschlagen werden. Es gibt Berichte über Boote, die nach Griechenland zurückgeschleppt werden, und das Schiffsunglück von Pylos, bei dem 600 Menschen ertrunken sind. Überlebende berichten, dass die griechische Küstenwache das Boot bewusst zum Kentern bringen wollte. Es wird kritisiert, dass es keinen Aufschrei über die vielen Toten gibt. Ein Fall wird erwähnt, in dem ein Mensch öffentlich über Foltererfahrungen auf EU-Boden berichtet, was eigentlich ein Riesen-Politikum sein müsste. Es ist unklar, wer die Folter verübt hat, da es ein Mischmasch aus Milizen und Grenztruppen gibt. In Polen gibt es eine Zone, in der keine Medienaufnahmen erlaubt sind. Es wird gefordert, dass die Signale über Menschenrechtsverletzungen an den Grenzen medial verbreitet werden. Es wird auf die Gefahr hingewiesen, dass diese Gewalt nach innen eskaliert, wie Natascha Stroh sagt. Es wird die Frage aufgeworfen, auf welchem Weg wir uns befinden und ob wir es schaffen, diesen Weg zu verlassen. Es wird auf die aktuelle Berichterstattung aus Los Angeles verwiesen, wo Menschen abgeschoben werden, die seit vielen Jahren dort leben. Auch in Deutschland werden Arbeitskollegen abgeholt oder Familien auseinandergerissen. Es wird befürchtet, dass es bald zu ähnlichen Zuständen wie in den USA kommt, wo Leute eingesammelt werden. Illegale Zurückweisungen an den deutschen Grenzen sind bereits Realität. Es wird gefragt, wie der Film in der Politik ankommt. Es gibt Interesse von Ortsgruppen bei SPD und Grünen, die den Film in ihren Kreisen zeigen und Debatten anstoßen wollen. Der Film bietet die Möglichkeit, gemeinsam über die Frage zu diskutieren, wie weit man nach rechts mitgehen will und wann man die Handbremse ziehen muss. Abschließend wird dazu aufgerufen, den Film zu unterstützen und Kinos anzuschreiben, um Vorführungen zu organisieren.