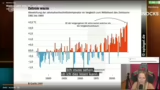Maja Göpel bei Lanz //
Maja Göpel diskutiert Klimawandel bei Lanz: Globale Erwärmung, Maßnahmen & Kritik
Die Sendung 'Markus Lanz' beleuchtete Klimawandel mit Maja Göpel. Debattiert wurden globale Erwärmung, lokale Maßnahmen in Tübingen, Technologiefeindlichkeit und Deutschlands Rolle. Kritisiert wurde Technologiefeindlichkeit und Klimanationalismus. Die Sendung umfasste Themen wie CCS, Kernenergie und die Notwendigkeit internationaler Zusammenarbeit für Klimaneutralität.
Emotionale Reflexionen und Vorbereitung auf Markus Lanz
00:00:45Die Streamerin teilt ihre emotionalen Erfahrungen nach dem Besuch des Films 'Kein Land für Niemand', der sie sehr bewegt hat. Sie spricht über das Bedürfnis, die Eindrücke sacken zu lassen und die Schwierigkeit, nach dem Film noch soziale Interaktionen aufrechtzuerhalten. Trotz der emotionalen Belastung freut sie sich auf den bevorstehenden Stream und die gemeinsame Reaktion auf 'Markus Lanz' mit Maja Göpel. Es wird erwähnt, dass bei Premieren des Films oft Ansprechpartner von C.I. anwesend sind, um die Zuschauer aufzufangen, was als sehr positiv hervorgehoben wird. Die Streamerin erwähnt auch, dass sie einige der im Film gezeigten Personen kennt, die auch bei SOS Humanity arbeiten. Sie plant, den älteren Film von Mike von 2016 auf YouTube anzusehen und fragt, ob sie den Stream heute abend etwas ruhiger angehen soll. Persönliche Herausforderungen, wie ein bevorstehendes Date, werden ebenfalls thematisiert, wobei die Streamerin ihre Unsicherheit und Erschöpfung in Bezug auf neue soziale Kontakte zum Ausdruck bringt. Sie erwähnt DJ-Streams mit Tech-House- und Afro-House-Playlists, die in Zukunft geplant sind und wahrscheinlich ohne viel Sprechen stattfinden werden.
Ankündigung neuer Emotes und bevorstehender Gastauftritt
00:08:27Die Streamerin präsentiert stolz neue Emotes, die von Juni erstellt wurden, darunter ein Emote mit Ohrringen und ein weiteres mit einem 'Arschwackler'. Sie betont, wie gut ihr die Emotes gefallen und wie vielseitig einsetzbar das 'Arschwackler'-Emote ist. Des Weiteren kündigt sie an, dass ab 12 Uhr Konrad zu Gast sein wird und dass sie gemeinsam 'Markus Lanz' schauen werden. Die Streamerin äußert ihre Begeisterung darüber, Maja Göpel in Aktion zu sehen und betont, dass die Sendung eine Stunde und 15 Minuten dauert, weshalb der Stream nicht allzu spät beginnen wird. Sie spricht über ihren 'Weltschmerz' und ihr Gefühl, nicht genug zu tun und nicht genug Veränderung zu bewirken. Gespräche mit Till über Aktivismus und die Erkenntnis, dass es nie genug sein wird, werden erwähnt. Die Streamerin hadert mit Twitch als Plattform und dem Desinteresse vieler Menschen an wichtigen Themen, lobt aber auch Influencer, die sich positionieren und mit System und Politik hadern. Eine Partnerschaft mit Snox wird positiv hervorgehoben, und die Streamerin betont, dass ihr Arbeit und Aktivität helfen, mit ihren Gefühlen umzugehen.
Spenden für Seenotrettung und Vorbereitung auf Markus Lanz
00:19:25Die Streamerin bedankt sich bei C-Top und McKnockback für ihre Spenden für die Seenotrettung und hebt hervor, dass C-Top sich für ein Armband melden soll. Sie erwähnt ein Treffen mit Numeria, die die Armbänder hergestellt hat, und kündigt einen 12-Stunden-Stream für die Community am 3. August an, bei dem auch wieder Seenotrettungsarmbänder geknüpft werden sollen. Anschließend bereitet sie sich darauf vor, 'Markus Lanz' mit Maya Göpel anzusehen, und äußert ihre Hoffnung, dass es um Klimawandel-Themen geht. Sie betont, dass die Sendung auch einen 'Hardcore-Klimawandel-Leugner' beinhaltet und dass sie und ihre Community versuchen werden, die Aussagen einzuordnen, wobei sie Maya Göpel als Expertin hervorhebt. Die Streamerin appelliert an einen User, der sich über die Regenbogenflagge beschwert hat, sich zu entspannen und den Stream zu genießen. Sie erwähnt, dass Marc Bennecke vorgeschlagen hat, eine Sendung aus dem Europaparlament anzusehen, und dass sie dies gerne in Zukunft tun würden. Sie betont, dass sie regelmäßig Pausen machen werden und dass ihr Gast Konrad um 12 Uhr kommt. Sie äußert die Hoffnung, dass die Sendung mit Maya Göpel keine 'Shitshow' wird und dass Maya Göpel die Aussagen einordnen wird.
Diskussion über Klimawandel und politische Verantwortung bei Markus Lanz
00:23:39Die Streamerin beginnt, die 'Markus Lanz'-Sendung zu kommentieren, die mit Bildern von Überschwemmungen in Texas und Aussagen der Bundesregierung zum Klimaschutz eingeleitet wird. Sie lobt Markus Lanz für seine klare Positionierung als Moderator. Die Streamerin fasst die Einführung der Gäste zusammen, darunter Maja Göpel, Boris Palmer und Axel Bojanowski, und betont die unterschiedlichen Perspektiven auf den Klimawandel. Sie hebt hervor, dass Boris Palmer in Tübingen versucht, Veränderungen im Bereich Klimaschutz umzusetzen, und dass Maja Göpel als sehr stabil wahrgenommen wird. Die Streamerin erwähnt, dass Palmer kritisiert, dass Politiker jedes Wetterereignis mit dem Klimawandel in Verbindung bringen, und dass er den Alarmismus ablehnt. Sie fragt nach einer Quelle für eine Aussage von Palmer und grenzt ihre positive Bewertung auf seine Klimawandeltechnik in Tübingen ein. Die Streamerin kommentiert die Aussage von Jochem Marotzke, dass die Welt riskanter wird, aber nicht untergehen wird, und dass die 1,5 Grad eine politische Zahl sind. Sie betont, dass Marotzke und Göpel 'based' in der Runde sind und dass ein 'armer Mensch' in der Runde sitzt, der die Klimakrise verharmlost. Sie erwähnt, dass Palma in einer früheren Sendung eine Neurowissenschaftlerin respektlos behandelt hat. Die Streamerin betont, dass es wichtig ist, den Zusammenhang zwischen Treibhauseffekt und anthropologischem Einfluss zu verstehen. Sie äußert ihre Vorfreude auf eine gute Folge und begrüßt Jochen Marotzke in der Sendung.
Globale Erwärmung und Wettereignisse: Schutzmaßnahmen und Anpassung
00:50:47Es wird festgestellt, dass die globalen Schäden und Todesfälle durch Stürme insgesamt abgenommen haben, was auf verbesserte Schutzmaßnahmen zurückzuführen ist. Dies wird jedoch nicht als Widerlegung der globalen Erwärmung interpretiert. Es wird betont, dass man einzelne Wettereignisse nicht direkt dem Klimawandel zuordnen kann, obwohl die globale Erwärmung ein Problem darstellt. Klimaforscher Joachim Marotzke erklärt, dass Hitzewellen durch den Klimawandel zunehmen und weltweit häufiger auftreten, während die Auswirkungen von Niederschlägen weniger sicher sind. Es wird hervorgehoben, dass die Menschheit sich nicht dauerhaft an den Klimawandel anpassen kann, wenn dieser fortschreitet. Daher ist es wichtig, sowohl Emissionen zu reduzieren als auch sich an unvermeidliche Veränderungen anzupassen. Es wird betont, wie wichtig es ist, in einem komplexen Problem wie dem Klimawandel nicht zu verallgemeinern und verschiedene Aspekte zu berücksichtigen.
Klimawandel-Leugnung, Hitzeextreme und gesellschaftliche Realitäten
00:55:29Es wird kritisiert, dass die Klimawandel-Leugner-Szene, einschließlich Teilen der AfD, extreme Temperaturen als normalen Sommer abtut. Es wird betont, dass Temperaturen ab 36 Grad potenziell tödlich sein können, insbesondere in Verbindung mit hoher Luftfeuchtigkeit. Es wird festgestellt, dass es eine Verbindung zwischen Klimaleugnung, Ablehnung von Sonnenschutz und Impfverweigerung gibt, oft bei patriotischen AfD-Wählern. Die Diskussion berührt die physiologischen Grenzen des Menschen bei extremer Hitze und hoher Luftfeuchtigkeit, wobei Situationen wie die Flucht übers Mittelmeer als besonders gefährlich hervorgehoben werden. Es wird die Frage aufgeworfen, warum Klimaanlagen oft kritisiert werden, obwohl sie in solchen Situationen lebensrettend sein können. Es wird darauf hingewiesen, dass viele Menschen sich weder Klimaanlagen noch Balkonkraftwerke leisten können, was die soziale Ungleichheit in Bezug auf Klimaanpassung verdeutlicht. Viele Menschen haben keine Ersparnisse, um solche Investitionen zu tätigen.
Medizinische Kosten und Klimaanlagen als Segen für die Menschheit
01:01:10Es wird die Problematik steigender medizinischer Kosten und deren Auswirkungen auf den Einzelnen thematisiert, insbesondere im Hinblick auf Medikamente und Zuzahlungen. Es wird betont, dass sich viele Menschen Medikamente kaum leisten können, was die soziale Ungleichheit verdeutlicht. Die Diskussion schwenkt zurück zum Thema Klimawandel, wobei Klimaanlagen als eine große Erfindung und ein Segen für die Menschheit dargestellt werden. Es wird argumentiert, dass Klimaanlagen die Besiedlung südlicherer Regionen ermöglicht haben und Metropolen in den Tropen wachsen ließen. Deutschland wird für seine Technophobie kritisiert, die den Einsatz von Klimaanlagen behindert. Es wird hervorgehoben, dass Klimaanlagen in anderen Regionen der Welt selbstverständlich sind. Die Sinnhaftigkeit von Klimaanlagen wird infrage gestellt, während Wissenschaftler hilflos daneben sitzen müssen.
Globale Erwärmung, Klimaziele und lokale Maßnahmen in Tübingen
01:12:09Es wird erklärt, dass sich die globale Durchschnittstemperatur um 1,2 Grad erhöht hat, wobei sich Landflächen stärker erwärmen als Ozeane. Europa hat sich in den letzten 20 Jahren besonders stark erwärmt, was bedeutet, dass Deutschland stärker von der Erwärmung betroffen ist. Es wird betont, dass das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Abkommens bedeutet, dass die Erwärmung über Land deutlich höher sein wird. Um ein unkontrollierbares Klimaregime zu verhindern, müssen die CO2-Emissionen gesenkt werden. Bürgermeister Boris Palmer erläutert die Maßnahmen, die in Tübingen ergriffen werden, um bis 2030 klimaneutral zu werden. Dazu gehören Investitionen in Entsiegelung, Baumpflanzungen und die Schaffung von Wasserflächen in der Innenstadt, um die Stadt zu kühlen. Es werden auch Konzepte für Hitzeschutzräume entwickelt, wie z.B. die Nutzung von Fußgängertunneln als kühle Rückzugsorte. Im Bereich des Hochwasserschutzes wurden Starkregenkarten erstellt und die Stadt an den Gewässern auf ein 100-jähriges Hochwasser ausgebaut.
Klimaschutz und Wirtschaft: Tübingens Ansatz für eine nachhaltige Zukunft
01:20:30Es wird betont, dass langfristiger Klimaschutz nicht funktionieren kann, wenn er der Wirtschaft schadet. Die Idee ist, Win-Win-Situationen zu schaffen, in denen Wirtschaft, Lebensqualität, Wohlstand und Klimaschutz gemeinsam vorankommen. In Tübingen wurden verschiedene Maßnahmen ergriffen, die es sonst in Deutschland nicht gibt, wie z.B. eine Verpackungssteuer auf To-Go-Produkte, um den Materialverbrauch und die CO2-Emissionen zu reduzieren. Es wird massiv in die Radinfrastruktur investiert, was zu einem Anstieg des Radverkehrsanteils und einem Rückgang des Autoverkehrs geführt hat. Das Deutschlandticket wird mit städtischen Geldern subventioniert, und die Anwohnerparkgebühren, insbesondere für SUVs, wurden deutlich erhöht, um den öffentlichen Nahverkehr zu finanzieren. Diese Maßnahmen werden überwiegend positiv aufgenommen, da sie den Busverkehr attraktiver machen und die Innenstadt beleben. Es wird argumentiert, dass die Verteuerung des Parkens in der Innenstadt und die Förderung von Park-and-Ride-Systemen dazu beitragen, den Autoverkehr zu reduzieren und den öffentlichen Nahverkehr zu finanzieren.
Angst vor dem Klimawandel bei Kindern und Küstenschutzmaßnahmen
01:31:43Es wird die Problematik diskutiert, wie Kindern in Schulen oft das Gefühl vermittelt wird, dass die Welt untergeht, was zu Angst und Sorge führt. Es wird die Geschichte erzählt, wie der Gesprächspartner seinem Sohn, der Angst vor dem steigenden Meeresspiegel hatte, die Küstenschutzanlagen in Hamburg zeigte, um ihm die Angst zu nehmen. Es wird betont, wie wichtig es ist, Kindern realistische Informationen zu geben und ihnen zu zeigen, dass es Schutzmaßnahmen gibt. Es wird die Flut von 2013 in Hamburg erwähnt, bei der dank der Küstenschutzmaßnahmen keine Menschen ums Leben kamen. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass Küstenschutzmaßnahmen nur Symptome behandeln und nicht die Ursachen des Klimawandels bekämpfen. Es wird argumentiert, dass man auch einem Fünfjährigen erklären kann, dass es wichtig ist, die Ursachen des Klimawandels zu bekämpfen, anstatt nur Symptome zu behandeln. Der Küstenschutz in Hamburg und an der Nordsee wird als vorbildlich gelobt, aber es wird betont, dass es wichtig ist, auch die Maßnahmen der Niederländer zu betrachten, die zu einem Viertel unter dem Meeresspiegel liegen und dennoch das bestgeschützte Land der Welt sind.
Niederlande und Klimawandel: Realistische Darstellung vs. Superlative
01:37:58Die Diskussion dreht sich um die Bedrohung der Niederlande durch den steigenden Meeresspiegel. Es wird kritisiert, dass oft übertriebene Superlative verwendet werden, anstatt eine realistische Darstellung der Situation zu geben. Während die Niederlande als ein Land mit fortschrittlichen Schutzmaßnahmen gelten, wird betont, dass auch sie an ihre Grenzen stoßen werden. Die Technologie zur Abwehr eines Meeresspiegelanstiegs von fünf Metern sei zwar vorhanden, aber es wird bezweifelt, ob man es darauf ankommen lassen sollte. Die Schutzmaßnahmen der Niederlande sind beeindruckend, aber der Grund für ihre Notwendigkeit, nämlich das Versäumnis der Weltbevölkerung, rechtzeitig gegen den Klimawandel vorzugehen, ist траurig. Es wird betont, wie wichtig es ist, einen positiven Ansatz für Fortschritt und Entwicklung zu haben, anstatt sich nur auf Katastrophenszenarien zu konzentrieren. Die Bild-Zeitung, für die ein Diskussionsteilnehmer arbeitet, wird dafür kritisiert, dass sie wenig Interesse an den Ursachen des Klimawandels zeigt. Maja Göpel betont die Notwendigkeit, verschiedene Aspekte wie konsequente Maßnahmen, Technologiesprünge und Lösungen zu kombinieren, um CO2-Emissionen zu reduzieren und die Anpassung an den Klimawandel zu verbessern. Sie verweist auf das Netzwerk 'Mission Wertvoll', das Erfolgsgeschichten in diesem Bereich sichtbar macht.
15-Minuten-Stadt Konzept: Paris als Vorbild für systemische Innovation
01:40:42Anne Hidalgo und Paris werden als Beispiel für eine systemische Innovation genannt. Paris hat das Konzept der 15-Minuten-Stadt umgesetzt, um die Lebensqualität der Bewohner zu verbessern. Anstatt ein autofreies Paris zu fordern, wurde eine Stadt geschaffen, in der alle wichtigenAlltagstätigkeiten in 15 Minuten erreichbar sind. Dies reduziert die Notwendigkeit, sich über große Distanzen fortzubewegen und verbessert die Lebensqualität. Das Konzept basiert auf räumlichem Denken und der optimalen Nutzung von Quadratmetern. Es erfordert Durchhaltevermögen, da es zunächst zu Widerstand und Baustellen kommt, aber letztendlich zu veränderten Lebensstilen führt. Tübingen wird als Beispiel für eine Kommune genannt, die in Deutschland in den 90er Jahren ein ähnliches Konzept im französischen Viertel umgesetzt hat. Die Verkehrswende in Tübingen wird als Beispiel genannt, bei dem der Autoverkehrsanteil gering ist. Die Stadtwerke erzeugen 100 Prozent des benötigten Stroms aus erneuerbaren Energien. Die Wärmewende hinkt jedoch hinterher, weshalb auf Fern- und Nahwärme gesetzt wird. Eine Großwärmepumpe soll zukünftig ein Zehntel des Wärmebedarfs decken. Der Bau eines Backbone-Netzes für die Fernwärme ist im Gange, aber es fehlt noch das Kapital für die 60 Millionen Euro teure Großwärmepumpe. Bürokratische Hürden erschweren die Zusammenarbeit mit dem Land Baden-Württemberg.
Bürokratie vs. Klimaschutz: Genehmigungsverfahren und das Bundesohrengesetz
01:45:46Es wird die Schwierigkeit von Genehmigungsverfahren für Klimaschutzmaßnahmen kritisiert. Selbst für einfache Projekte wie eine Abwassergrube oder ein Gebäude mit Solaranlagen dauern die Genehmigungen oft Jahre. Es wird gefordert, dass die Bürokratie vereinfacht und abgebaut wird. Als Beispiel wird ein 'Bundesohrengesetz' vorgeschlagen, das es ermöglichen würde, Solaranlagen auf Flächen entlang von Autobahnen zu bauen, ohne jahrelange Planungsverfahren durchlaufen zu müssen. Es wird kritisiert, dass die Hauptaufgabe von Oberbürgermeistern oft darin besteht, Vorschriften zu ignorieren, um überhaupt etwas zu erreichen. Es wird die Frage aufgeworfen, warum es immer einen Konflikt zwischen Klimaschutz und Wirtschaft geben muss. China wird als Beispiel genannt, das zeigt, dass beides sehr gut zusammengehen kann. Es wird jedoch auch darauf hingewiesen, dass China gleichzeitig der größte CO2-Emittent der Welt ist. Wenn alle so argumentieren würden wie Herr Merz, der sich zurücklehnt, bis die anderen anfangen zu arbeiten, dann wäre das fatal. Die Europäische Union sollte stattdessen eine Stabilitätsanker sein, insbesondere wenn Donald Trump aus den Klimaabkommen aussteigt.
Technologiefeindlichkeit und Klimanationalismus: CCS, Kernenergie und die Rolle Deutschlands
01:52:15Es wird betont, dass die Elektrifizierung und erneuerbare Energien sicherer, flexibler und weniger abhängig machen. Es wird festgestellt, dass es zum ersten Mal eine Entkopplung des Wachstums von den CO2-Emissionen gibt. Die CO2-Rechnung kann unterschiedlich aufgestellt werden, z.B. als Pro-Kopf-Rechnung oder historisch betrachtet. Die Länder, die durch Industrialisierung reich geworden sind, tragen eine größere Verantwortung bei der Bekämpfung des Klimawandels. Es wird auf das Interesse Chinas an Kooperationen im Bereich grüne Technologien und Digitalisierung hingewiesen. Deutschland wird kritisiert, sich zu sehr auf das eigene Land zu konzentrieren bei der CO2-Reduktion (Klimanationalismus). Es wäre effektiver, CO2-Reduktion im Ausland zu fördern, z.B. durch Aufforstung oder CCS (Carbon Capture and Storage). Deutschland hat CCS im Jahr 2013 verboten, obwohl es von der Erdölindustrie seit Jahrzehnten praktiziert wird. Es wird kritisiert, dass in Deutschland eine Technologiefeindlichkeit herrscht, die sich gegen jede Art von moderner Technologie wendet. Andere Länder machen das Geschäft mit Klimatechnologie, während Deutschland, das diese Technologien oft entwickelt hat, außen vor ist. Es wird betont, dass alles, was geht, an den Start geschoben werden sollte, sowohl die Abscheidung von CO2 als auch die CCS-Technologie.
Diskussion über Kernenergie, CO2-Abscheidung und Respekt in der Gesprächsführung
02:21:40Es wird über die Menge an CO2-Emissionen und den Aufwand für deren Reduktion diskutiert, wobei eine generelle Technikfeindlichkeit kritisiert wird. Die Gesprächsführung von Lanz wird analysiert, wobei der Fokus auf seinem Umgang mit Maja Göpel liegt. Es wird argumentiert, dass Göpel diplomatisch begann, aber oft unterbrochen wurde, was schließlich zu einer lauteren Gesprächsweise führte, um überhaupt gehört zu werden. Die Diskussionsteilnehmer äußern ihre Skepsis bezüglich des Potenzials der Kernenergie zur Bekämpfung des Klimawandels und verweisen auf den weltweit rückläufigen Anteil der Kernenergie an der Stromerzeugung sowie die hohen Investitionen, die erforderlich wären, um fossile Brennstoffe zu ersetzen. Es wird betont, dass viele Staaten sich gegen den Ausbau von Kernkraftwerken entscheiden, mit Ausnahme derjenigen, die auch Kernwaffen besitzen. Die teure Illusion der Kernenergie lenke von sinnvolleren politischen Diskussionen ab, wie dem Bau von Stromtrassen. Abschließend wird die Körpersprache von Lanz als respektlos gegenüber anderen Gesprächsteilnehmern interpretiert, während Göpels Reaktion als berechtigt angesehen wird.
Energiebedarf, Klimawandel-Akzeptanz und politische Hindernisse für die Energiewende
02:27:29Der weltweit steigende Energiebedarf, insbesondere durch KI und Rechenzentren, wird als enorm beschrieben, wobei das Wachstum jährlich einer japanischen Volkswirtschaft entspreche. Technologieunternehmen investieren in neue Technologien, da erneuerbare Energien allein den Bedarf nicht decken könnten. Gleichzeitig wird argumentiert, dass man sich nicht von den eigentlichen Zielen ablenken lassen sollte, wie es auch Frau Göpel tue. Die sinkende Akzeptanz des Klimawandels in der Bevölkerung, wo nur noch 40 Prozent der Deutschen ihn als wichtig erachten, wird als Problem dargestellt. Es wird kritisiert, dass die Energiewende in Deutschland nicht kosteneffizient sei, was zu Akzeptanzproblemen führe. Als Beispiel wird das Verbot oberirdischer Hochspannungsleitungen durch Herrn Seehofer genannt, das die Kosten um 30 Milliarden erhöhe. Bürgerinitiativen, die sich gegen Windräder aussprechen, werden ebenfalls als Hindernis genannt, wobei argumentiert wird, dass der Strombedarf der Industrie gedeckt werden müsse. Ein konkretes Beispiel aus Tübingen wird angeführt, wo ein idealer Windstandort aufgrund von Einwänden der Bundeswehr bezüglich Tiefflugstrecken nicht genutzt werden kann.
Europäische Zusammenarbeit und internationale Absprachen für Klimaneutralität
02:38:17Es wird betont, dass Deutschland nicht im Alleingang klimaneutral werden kann, sondern europäische Zusammenarbeit notwendig ist. Spanien mit seiner hohen Sonneneinstrahlung wird als Beispiel genannt, um Energieversorgungssysteme gemeinsam zu denken. Es wird davor gewarnt, dass das Einsparen von fossilen Brennstoffen in der EU dazu führen könnte, dass diese anderswo billiger verbrannt werden. Internationale Absprachen seien notwendig, um die Bewahrung des Gemeinschaftsguts zu gewährleisten, selbst wenn es keine Eigeninteressen von Ländern wie Saudi-Arabien gäbe. Es wird hervorgehoben, dass Europa nicht isoliert agieren kann und Allianzen benötigt, um die Abwärtsspirale zu verhindern. Brasilien unter Präsident Lula wird als Beispiel für ein Land genannt, das plurilaterale Abkommen und Klimaclubs aufbaut. Die Vorteile erneuerbarer Energien, die auch sichere Energien sind, werden betont, insbesondere im Hinblick auf die Abhängigkeit von Gas und die damit verbundene Erpressbarkeit. Technologie- und Kofinanzierungsprogramme könnten Ländern helfen, die nicht auf fossile Brennstoffe setzen müssen. Es wird betont, dass Klimaschutz und Wirtschaftlichkeit vereinbar sind und dass Politik und Medien die Aufgabe haben, dies zu vermitteln.
Dynamische Stromtarife, Smart Meter und die Rolle von Rabot Energy in der Energiewende
02:55:49Es wird erklärt, dass dynamische Stromtarife es ermöglichen, Strompreise an die tatsächlichen Kosten anzupassen, sodass Verbraucher von günstigen Preisen profitieren können, wenn viel Sonnenenergie verfügbar ist. Ein Smart Meter übermittelt alle 15 Minuten automatisch den Zählerstand an den Energieversorger, was die Grundlage für dynamische Stromtarife bildet. Rabot Energy, ein moderner, digitaler Energieversorger, bietet solche Tarife an und ermöglicht es Kunden, von der Energiewende zu profitieren. Aktuell bezieht Rabot Ökostrom aus Norwegen, Slowenien und Spanien, wobei Zertifikate verwendet werden, um Projekte für Windkraftanlagen und Solarparks zu fördern. Der Fokus liegt darauf, Haushalten den Zugang zur Energiewende zu ermöglichen, anstatt eigene Windparks zu kaufen, was teuer wäre. Der europäische Strommarkt wird als transparent und unabhängig beschrieben, wo Angebot und Nachfrage den Preis bestimmen. Es wird ein Fall aus Frankreich erwähnt, wo Atomkraftwerke aufgrund von zu warmem Flusswasser abgeschaltet werden mussten, was zu einem Stromproblem führte, das durch deutschen Solarstrom teilweise ausgeglichen werden konnte.
Netzdienliche Stromspeicherung und regulatorische Hürden
03:10:21Es wird über die Problematik der Netzentgelte bei eigener Stromspeicherung gesprochen, obwohl man netzdienlich agiert. Es wird kritisiert, dass trotz der Entlastung des Netzes durch die Nutzung von überschüssigem Mittagsstrom und der Rückgabe am Abend, Netzentgelte anfallen. Verhandlungen mit zahlreichen Netzbetreibern gestalten sich schwierig. Ein weiteres Problem stellt eine Norm dar, die vorschreibt, dass die Installation von Speichern von einem Elektrotechniker abgenommen werden muss, selbst bei kleinen Heimspeichern, die an die Steckdose angeschlossen werden. Diese Regulierungswut in Deutschland wird als hinderlich empfunden, aber es wird betont, dass man Wege findet, diese zu umgehen. Das Ziel ist es, dass jeder sich einfach einen Speicher mit einem Smart Meter hinstellen und den Strom nach Bedarf verbrauchen kann, wissend, dass er aus Sonnenenergie stammt.
Paragraph 14a des Energiewirtschaftsgesetzes: Dimmung von Stromverbrauchern zur Netzstabilisierung
03:12:27Der Stream wechselt zu Paragraph 14a des Energiewirtschaftsgesetzes, der seit dem 1. Januar 2024 in Kraft ist. Dieser Paragraph befasst sich mit dem Problem der Netzinstabilität, die durch die zunehmende Disbalance zwischen Stromproduktion und -verbrauch entsteht. Um zu verhindern, dass abends zu viele Gaskraftwerke anspringen müssen, wurde die Idee entwickelt, parallel Verbraucher abschalten zu können. Dies betrifft jedoch nur Verbraucher im Haushalt, die über 4,2 Kilowatt ziehen, hauptsächlich Wallboxen mit Elektroautos und Wärmepumpen. Ursprünglich war geplant, dass der Netzbetreiber diese Verbraucher abschalten darf, was jedoch zu einem Aufschrei führte. Daraufhin wurde die Regelung geändert, sodass der Netzbetreiber nun dimmen darf, wodurch die Ladeleistung der Wallbox reduziert wird, ohne dass der Nutzer es merkt. Es wird betont, dass dies nur für kurze Zeiträume geschieht und keine stundenlangen Abschaltungen vorsieht.
Vorteile und Umsetzung von Paragraph 14a: Entschädigung und dynamische Netzentgelte
03:16:09Paragraph 14a bietet Kunden einen Vorteil, da sie eine Entschädigung zwischen 120 und 190 Euro pro Jahr erhalten, wenn sie dem Netzbetreiber erlauben, ihre Wallbox oder Wärmepumpe bei Bedarf zu dimmen. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, von dynamischen Netzentgelten zu profitieren, die mittags günstiger sind, um einen Anreiz für netzdienliches Verhalten zu schaffen. Um Paragraph 14a nutzen zu können, benötigt man eine Wärmepumpe oder eine Wallbox, einen Smart Meter und eine Steuerbox, die vom Netzbetreiber installiert wird. Die Verbindung zwischen Wallbox und Steuerbox muss physisch per Kabel erfolgen. Es wird jedoch bezweifelt, dass die Netzbetreiber tatsächlich von der Dimmung Gebrauch machen werden, da der Aufwand zu groß sei und sie stattdessen lieber ein Gaskraftwerk anwerfen würden. Trotzdem profitiert man als Kunde allein schon durch die Anmeldung von Paragraph 14a.
Gamifizierung des Stromverbrauchs und Kooperationen für eine smarte Energiewende
03:20:18Es wird die Notwendigkeit betont, Alltagsgewohnheiten der Menschen im Bezug auf Stromverbrauch zu ändern und dies durch Gamifizierung zu fördern, beispielsweise durch eine Smartwatch, die zum Laden des E-Autos auffordert, wenn der Strom günstig ist. Eine Geräteverbundenheit zu stromintensiven Geräten wie Waschmaschinen wird ebenfalls als sinnvoll erachtet. Es wird überlegt, Rankings oder Achievements in einer App einzuführen, um den Stromverbrauch zu optimieren. Kooperationen mit großen Haushaltsgeräteherstellern werden angestrebt, um deren Geräte so anzusteuern, dass sie beispielsweise die Waschmaschine erst starten, wenn der Strom besonders günstig ist. Das Ziel ist es, den Kunden das Leben nicht schwerer zu machen, sondern ihnen ein gutes Gefühl zu geben, wenn sie ihren Energieverbrauch optimieren und zur Energiewende beitragen.
Bewertung von Paragraph 14a und politische Einflussfaktoren auf die Energiewende
03:23:31Paragraph 14a wird kritisch betrachtet, da hauptsächlich Eigenheimbesitzer davon profitieren. Positiv hervorgehoben werden jedoch die dynamischen Netzentgelte, die mittags günstigeren Strom ermöglichen. Zuständig für die Weiterentwicklung ist das Bundeswirtschafts- oder Energieministerium unter Katharina Reiche sowie die Bundesnetzagentur. Es wird bemängelt, dass politische Entscheidungen oft kurzfristig geändert werden, was die Planbarkeit erschwert. Um die Energiewende voranzutreiben, wäre eine Entbürokratisierung notwendig, beispielsweise durch den Wegfall der Installateurpflicht für Heimspeicher und schnellere Prozesse bei der Umstellung auf 15-Minuten-Messwerte bei Smart Metern. Die Angst vor Black-Swan-Momenten führt oft zu unnötigen Komplikationen für die Mehrheit der Nutzer.
Zukunft der Energiewende und Rolle von Kohle und Atomkraft
03:27:53Es wird diskutiert, ob Kohle und Atomkraft unter der neuen Bundesregierung wieder eine größere Rolle spielen werden. Es wird jedoch bezweifelt, dass dies der Fall sein wird, da selbst RWE-Chef Leo Birnbaum Atomkraft ablehnt und sich der Schritt aufgrund der hohen Kosten nicht mehr rechnen würde. Grundsätzlich wird der eingeschlagene Weg der Regierung als richtig empfunden, jedoch wird eine Beschleunigung gefordert. Um Einfluss zu nehmen, setzt das Unternehmen auf PR-Arbeit und Zusammenarbeit mit Wettbewerbern, um Druck über die Medien auf die Politik auszuüben. Energiekonsultationen finden hauptsächlich auf nationaler Ebene statt, wobei Verbände, Netzbetreiber und Energiekonzerne einbezogen werden. Es wird bevorzugt, in die Breitenwirkung zu investieren und eine kritische Masse zu erzeugen, um Gesetze entsprechend anzupassen.
Mythen und Fakten rund um die Energiewende und dynamische Stromtarife
03:37:10Es werden Missverständnisse und Vorurteile bezüglich der Energiewende und des flexiblen Stromverbrauchs thematisiert. Eine häufige Angst ist, dass es dunkel werden könnte, wenn keine Sonne scheint. Es wird jedoch klargestellt, dass niemand im Dunkeln sitzen wird, da ein physisches Abschalten nur bei Zahlungsverzug erfolgt. Auch im Winter funktionieren dynamische Stromtarife, da Windkraftanlagen in der Nordsee einen hohen Anteil erneuerbarer Energien liefern. Eine Dunkelflaute kann zwar zu höheren Preisen führen, aber im Schnitt spart man trotzdem. Ein weiterer Mythos ist, dass jeder mitlesen kann, wenn man einen Smart Meter hat. Tatsächlich hat der Smart Meter jedoch eine sehr hohe Sicherheitsanforderung und kommuniziert über eine verschlüsselte SIM-Karte mit dem Netzbetreiber. Es wird erläutert, welche Informationen aus den Smart-Meter-Daten gewonnen werden können, beispielsweise wann jemand zu Hause ist oder welche Geräte verwendet werden.
Smart Meter und Smart Home: Kommunikationsmöglichkeiten und Zukunftsvision
03:43:51Es wird die Frage beantwortet, ob ein Smart Meter mit einem Smart Home kommunizieren kann. Aktuell ist dies nur über ein Home Energy Management System (HEMS) möglich, da der Smart Meter keine direkte WLAN-Schnittstelle hat. Ein Installateur muss das HEMS mit dem Smart Meter verbinden. Alternativ stellt das Unternehmen die Messwerte über seine App zur Verfügung, jedoch mit einem Tag Versatz. Abschließend wird eine Zukunftsvision der Energiewende skizziert, in der jeder Haushalt in fünf Jahren in der Lage ist, die Energiewende mitzugestalten und davon zu profitieren. Der Ausbau erneuerbarer Energien und die Elektrifizierung werden weiter zunehmen, was zu stärkeren Disbalancen im Netz führt. Es wird jedoch daran gearbeitet, jedem Haushalt die Möglichkeit zu geben, dazu beizutragen und von den Vorteilen zu profitieren.