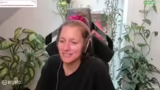daily dose politic
Politik & Gesellschaft: Diskussion um Verfassungsrichterwahl und Medienkampagnen
Die Diskussion dreht sich um die Verfassungsrichterwahl und die Kampagne gegen Frau Brosius-Gersdorf. Themen sind die Rolle der Medien, Plagiatsvorwürfe, die Haltung der CDU und die Bedeutung der Neutralität für Verfassungsrichter. Auch Bürgergeld, Frauenfußball und Upcycling werden behandelt. Mit Snox gibt es eine Kooperation.
Planung für Sonntags-Livestream mit Tanz und Überlegung für bunte Lichter
00:01:30Es wird überlegt, sonntags eine Abendveranstaltung mit Livestream und tanzenden Leuten im Hintergrund zu veranstalten, um die Stimmung im Raum zu erhöhen. Zusätzlich wird überlegt, von privatem Geld bunte Lichter für eine bessere Atmosphäre zu kaufen, um einen schönen Nachmittags-Rave zu veranstalten. Es soll heute in die Kuro News reingeschaut werden, da Syrien in den letzten Tagen nicht besprochen wurde und Kuro die Themen wahrscheinlich in den News hat. Ursprünglich aus der Rock- und Metal-Szene kommend, wird Techno als meditativ und angenehm empfunden, besonders wenn man sich darauf einlässt. Es wird überlegt, ob ein Urlaub auf einer einsamen Insel ausreicht oder ob man gleich auswandern muss und schlägt Lanz vor. Markus Lanz scheint einen Wandel durchzumachen und möglicherweise zu merken, dass es mit dem Rechtsextremismus eng wird.
Diskussion über Markus Lanz Interview mit Frau Kebrosius-Gersdorf und Kritik an der Berichterstattung
00:05:28Es wird überlegt, sich ein Einzelinterview von Markus Lanz mit Frau Kebrosius-Gersdorf anzusehen, da sie sehr klar gesagt hat, dass sie noch zur Verfügung steht, weil die Hetzjagd nicht gewinnen darf. Es wird kritisiert, dass Union und Kirchenräte ihren Rücktritt fordern und die Rechten sie als linksradikal darstellen. Die Taz wird als sehr links bezeichnet. Es wird betont, dass es bei der Hetzjagd nicht um Inhalte geht, sondern um Lügen. Medien, die diese Lügen publizieren, sollten bestraft werden, um die Demokratie zu schützen. Es wird eine Analogie zu Strafen im Straßenverkehr gezogen, wie z.B. Berufsverbote für Journalisten. Es wird die Frage aufgeworfen, wer die Medien regulieren soll und wie man ein System einführt, das Lügen bestraft, ohne die Pressefreiheit anzugreifen. Es wird kritisiert, dass die Zeitungen keine saubere Pressearbeit leisten und der Schaden durch Falschmeldungen angerichtet ist, selbst wenn es eine Gegendarstellung gibt. Die Mechanismen in Social Media verstärken das Problem, da Gegendarstellungen oft nicht die gleiche Reichweite haben wie die ursprünglichen Falschmeldungen.
Analyse der Berichterstattung über Frauke Brosius-Gersdorf und Kritik an der Instrumentalisierung durch rechte Medien
00:17:52Es wird ein Einzelinterview mit Frauke Brosius-Gersdorf bei Markus Lanz angekündigt. Es wird betont, dass sie eine exzellente Juristin ist, die eigentlich zur Verfassungsrichterin gewählt werden sollte, aber die Wahl scheiterte. Stattdessen stehen plötzlich Fragen zu ihrer Haltung zu Schwangerschaftsabbrüchen, Menschenwürde ungeborenen Lebens, einem AfD-Verbot und der Impfpflicht während Corona im Raum. Es wird die Frage aufgeworfen, ob sie tatsächlich eine linke Kulturkämpferin oder das Opfer einer Kampagne ist. Es wird kritisiert, dass die Wahl verschoben wurde und aus einer angesehenen Juraprofessorin plötzlich eine linke Aktivistin gemacht wurde. Die Stimmungsmache kam aus rechten Medien und wurde von der CDU übernommen. Es wird betont, dass dies Auswirkungen auf das demokratische System und Richterwahlen haben wird. Es wird vermutet, dass sie versucht, ihren Ruf wiederherzustellen, den sie unverschuldet verloren hat. Sie wird als Richterin beschrieben, die ihre persönlichen Überzeugungen nicht mit einfließen lassen darf und als extrem sachlich, rational und differenziert wahrgenommen wird. Es wird kritisiert, dass sie massiv Morddrohungen erhält und in rechten Kreisen fälschlicherweise behauptet wird, sie würde für die Abtreibung im neunten Monat werben. Die Union wird beschuldigt, sich von Trumpismus lenken zu lassen und es wird als Angriff auf das demokratische System durch rechte und rechtsextreme Mächte in Social Media und Magazinen gesehen.
Frauke Brosius-Gersdorf äußert sich zu den gegen sie erhobenen Vorwürfen und zur Berichterstattung
00:29:42Frauke Brosius-Gersdorf äußert sich zu den gegen sie erhobenen Vorwürfen und zur Berichterstattung über die Verfassungsrichterwahl. Sie betont, dass die Berichterstattung der letzten Wochen nicht spurlos an ihr und ihrem Umfeld vorbeigegangen ist. Sie möchte einen Beitrag zur Versachlichung der Debatte leisten, da in Teilen der Medien unvollständig, unsachlich und teilweise falsch berichtet wurde, insbesondere in Bezug auf den Schwangerschaftsabbruch. Sie kritisiert die Titulierungen als Ultralinks, Radikalinks bis hin zu Linksextremisten und die Äußerung des Bamberger Erzbischofs als Abgrund an Intoleranz und Menschenverachtung. Sie betont, dass sie sich für sozial Schwache und Minderheitenschutz einsetzt und dass ihre Positionen zur Rente eher konservativ sind. Sie erinnert daran, dass auch Vertreter der katholischen Kirche an die Verfassungswerte des Grundgesetzes gebunden sind. Sie bestätigt, dass sie Morddrohungen erhalten hat und dass es Videos in sozialen Netzwerken gab, in denen ihr mit einer Faust ins Gesicht geschlagen wurde. Sie kritisiert Vergleiche mit Nationalsozialisten und die Bezeichnung als Kindsmörderin. Sie betont, dass sie sich der Diskussion und der Kritik stellen muss, aber dass die Berichterstattung oft falsch und aus dem Zusammenhang gerissen war. Sie erklärt sich die Dimensionen der Berichterstattung nicht und hält die Politisierung einer Verfassungsrichterwahl für brandgefährlich. Sie befürchtet, dass das Ansehen und die Arbeitsfähigkeit des Bundesverfassungsgerichts gefährdet sind. Sie relativiert den Vorwurf der pauschalen Medienschelte und betont, dass sie von einzelnen Medien und Journalisten gesprochen hat, die sich auf anonyme Quellen aus der Politik berufen haben. Sie kritisiert, dass sich eine Ministerin anonym zu einer Kandidatin für das Bundesverfassungsgericht äußert. Sie betont, dass es viele gute Berichte gab, aber dass manche aufgesprungen sind, ohne sich selbst ein vollständiges Bild zu machen. Sie kritisiert, dass einzelne Thesen herausgepickt und Sätze falsch wiedergegeben wurden. Sie erklärt, dass die FAZ mit kritischer Berichterstattung anfing, dann die Welt und Robin Alexander kamen und schließlich Newsportale aufgesprungen sind. Sie betont, dass sie nicht wegen einzelner Themen und Thesen nominiert wurde, sondern wegen ihres wissenschaftlichen Wirkens, ihrer Befähigung, Leistung und Persönlichkeit. Sie erklärt, dass sie von der SPD-Fraktion gefragt wurde, ob sie sie vorschlagen dürfen und dass sie einen Tag darüber nachgedacht hat. Sie hat sich mit ihrem Mann besprochen, weil ein Wechsel nach Karlsruhe auch private Auswirkungen hat. Sie hat voller Freude zugesagt, weil es für eine Verfassungsjuristin eine tolle Aufgabe ist, das Grundgesetz zu wahren.
Reaktion auf Plagiatsvorwürfe und Umgang mit Unterbrechungen
00:47:16Die Berichterstattung über den Schwangerschaftsabbruch und die Plagiatsvorwürfe, die am Tag der Wahl aufkamen, wurden als unglaublich perfekt getimet wahrgenommen. Eine Rechtsanwaltskanzlei wurde beauftragt, die Vorwürfe zu prüfen, und eine Stellungnahme wird folgen. Der sogenannte 'Plagiatsjäger', der die Vorwürfe erhoben hatte, ruderte später zurück und ist Mitglied der AfD, was die Herkunft der Kampagne verdeutlicht. Es wurde betont, dass der Politik klar sein sollte, dass dies ein Versuch war, die Wahl zur Verfassungsrichterin zu verhindern. Die Situation betraf nicht nur die Person selbst, sondern auch ihren Mann, was professionelle Unterstützung erforderlich machte. Gespräche wurden mit Abgeordneten verschiedener Fraktionen geführt, wobei der Fokus auf der professionellen Prüfung des Vorwurfs lag. Es wird kritisiert, dass die Kampagne der AfD wirkte, unterstützt durch das Zuwinken von Spahn, und als alarmierendes Signal für die Demokratie gesehen wird. Es wird hervorgehoben, wie wichtig es ist, etwas zu versachlichen, was längst hoch emotionalisiert ist, und dass emotionaler Zuspruch in solchen Situationen notwendig ist. Es wäre beruhigend gewesen, wenn sich jemand aus der Führungsriege gemeldet hätte, um Unterstützung zuzusichern, aber es gab viel Unterstützung und Gesprächsangebote aus den politischen Reihen.
Berufsbild einer Verfassungsrichterin und Umgang mit politischer Positionierung
00:55:55Das Berufsbild einer Verfassungsrichterin unterscheidet sich von dem einer Wissenschaftlerin, da es sich um einen Rollenwechsel handelt. Während Wissenschaftler Themen frei wählen und die Verfassung auslegen, entscheiden Verfassungsrichter über herangetragene Fälle und sind Teil eines Kollegialorgans. Es geht um die Auslegung des Grundgesetzes und das Aufzeigen von Grenzen. Es wird betont, dass weltanschaulich neutrale Richter nicht existieren, Bürger aber moderate politische Positionen erwarten dürfen, um das Vertrauen in die Rechtsprechung zu gewährleisten. Wissenschaftler haben Positionen, und das überrascht in Karlsruhe niemanden. Es wird als richtig erachtet, dass jemand das Vertrauen der Wählenden genießt, aber es muss um wissenschaftliche Positionen gehen. Die Fähigkeit, medial gut zu antworten, wird hervorgehoben. Es wird klargestellt, dass die wissenschaftliche Arbeit keinen Anlass zu Missverständnissen gibt, auch wenn man sich klar ausdrückt. Eine frühere Formulierung zum AfD-Parteiverbotsverfahren wurde als unglücklich eingestuft, da sie missverstanden werden konnte. Es wird betont, dass ein Parteiverbot nicht die Probleme beseitigen würde, die Menschen zur Abwendung von der demokratischen Mitte veranlassen.
Mediale Kampagnen und die Rolle der Verfassungsrichterin
01:02:33Es wird betont, dass vieles, was medial passiert, kein Zufall ist, sondern Teil von Kampagnen. Es wird eine Sondersendung zu rechtsextremen Kampagnen gefordert, um zu zeigen, wie sie wirken und Einfluss auf das System haben. Die Gesprächspartnerin wird als angenehm und als die perfekte Gästin für Markus Lanz beschrieben, da sie sich auf die Verteidigung ihrer Positionen einlässt. Sie selbst sieht sich nicht als Medienprofi, sondern als Hochschullehrerin, die sich mit rechtlichen Problemen beschäftigt und die Verfassung auslegt. Es wird klargestellt, dass es bei Äußerungen zu einem Parteiverbotsverfahren immer darum ging, über die hohen Hürden nach dem Grundgesetz aufzuklären. Die wehrhafte Demokratie muss die Möglichkeit haben, sich gegen Verfassungsfeinde zu wehren, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind. Es wird kritisiert, dass aus dieser Bemerkung der Vorwurf des Aktivismus entsteht. Es wird betont, dass nicht sie entscheidet, ob ein Antrag gestellt wird, sondern die zuständigen Verfassungsorgane. Es wird ein Sabaton-Stream in Aussicht gestellt, sollte die AfD verboten werden. Es wird kritisiert, dass Markus Lanz sie zum dritten Mal drängt, ihre Aufgaben als Hochschullehrerin zu erklären.
Diskussion über Impfpflicht und Kontextualisierung von Aussagen
01:11:12Es wird klargestellt, dass es bei Äußerungen immer darum geht, über hohe Hürden zu informieren und dass ein Parteienverbot ein zweischneidiges Schwert ist. Eine allgemeine Impfpflicht gegen Covid-19 verstößt nicht gegen das Grundgesetz. Es wird betont, dass Juristen Argumente abwägen, um zu einem Schluss zu kommen. Die Gesprächspartnerin wird als zu fachlich für die meisten Lanz-Zuschauer eingeschätzt, aber in Fachkreisen wird ihre Versiertheit anerkannt. Es wird zwischen verschiedenen Zielgruppen für die Sendung unterschieden, wobei rechte Kräfte versuchen, sie niederzumachen. Es wird betont, dass es wichtig ist, darauf hinzuweisen, dass der Staat nicht nur die Freiheit der Ungeimpften schützen muss, sondern auch die Gesundheit der Geimpften. Die Corona-Maßnahmen sind im Spiegel der Zeit zu sehen, und die Stellungnahme war von den damaligen medizinischen Erkenntnissen geprägt. Es wird kritisiert, dass Aussagen aus dem Kontext gerissen werden. Die Mehrheit der Deutschen war damals für eine Impfpflicht. Es wird betont, dass Lanz versucht, die Situation einzuordnen, da sie absurd ist. Die Gesprächspartnerin wird als konservativ geframed, obwohl sie im linken Spektrum nicht als radikal gilt. Es wird auf die Verschiebung nach rechts im Diskurs hingewiesen. Der Aktivismusvorwurf kommt daher, dass sie einen Schritt weitergeht und das zweite vor dem ersten beschreibt. Es wird die Güterabwägung zwischen verschiedenen grundrechtlichen Positionen erläutert. Es wird darauf hingewiesen, dass es in den USA wieder Masernfälle gibt, weil Menschen sich nicht mehr impfen lassen. In der Pflege und für Kita-Kinder gibt es Impfpflichten.
Medienkampagne gegen Juristin und die Rolle des Bundesverfassungsgerichts
01:32:06Es wird kritisiert, dass Aussagen aus dem Jahr 2020 erneut aufgewärmt werden, was im Zusammenhang mit der gegen die Juristin geführten Kampagne steht. Es wird bezweifelt, dass das öffentlich-rechtliche Fernsehen diese Kampagne wissenschaftlich aufarbeiten wird, aber gehofft, dass dies auf Plattformen wie der Republika oder dem C geschieht. Die Aufgabe der Rechtswissenschaft wird betont, sich kritisch mit Urteilen des Bundesverfassungsgerichts auseinanderzusetzen. Die Frage, ob Lehrerinnen in Berlin ein Kopftuch tragen dürfen, wird im Kontext des Neutralitätsgebots diskutiert. Es gibt unterschiedliche Rechtsprechungslinien bezüglich des Kopftuchverbots für Lehrerinnen und Rechtsreferendarinnen. Als Wissenschaftlerin sei es wichtig, auf Widersprüche und Inkonsistenzen hinzuweisen. Das Neutralitätsgebot verbietet dem Staat die Identifizierung mit Religionsausübung, aber Staatsbedienstete geben ihre Grundrechte nicht ab. Der Staat identifiziert sich nicht mit dem Tragen eines Kopftuchs, wenn er es für alle gleichermaßen zulässt. Es gibt aber auch das Mäßigungsgebot für Beamte, das die Religionsausübung im Dienst im Einzelfall regulieren kann. Die Frage nach der persönlichen Überzeugung der Juristin wird aufgeworfen, da sie bisher keine emotionale Antwort gegeben hat. Es wird als alarmierendes Signal gesehen, dass sich eine potenzielle Kandidatin für das Verfassungsgericht rechtfertigen muss. Die Diffamierung einer Privatperson durch rechte und rechtsextreme Kräfte wird als Kulturkampf aus Amerika kritisiert. Die Ernennung zum Verfassungsgericht habe nichts mit demokratischem Wettbewerb zu tun, da es sich nicht um eine ausgeschriebene Stelle handelt. Die Juristin sei keine politische Person und sollte sich nicht in einer Landsendung rechtfertigen müssen.
Angriff auf das demokratische System und die Rolle der Medien
01:41:02Die Kampagne gegen die Juristin wird als Angriff auf das demokratische System und auf juristische Personen gesehen, die als verfassungstreu gelten. Es wird kritisiert, dass ihr Worte in den Mund gelegt wurden, was Druck auf die Union ausgeübt habe. Rechtsextreme Mächte treiben die Medien vor sich her, die aktiv Druck auf die Politik ausüben. Die Teilnahme an der Sendung bei Lanz sei ihre einzige Möglichkeit, die Dinge klarzustellen. Es wird hervorgehoben, dass Menschen aus der Wissenschaft die Kampagne nicht ernst genommen haben. Es wird die Frage aufgeworfen, ob es grundsätzlich falsch ist, sich medial mit neuen Verfassungsrichterinnen auseinanderzusetzen. Schwierig sei es, wenn sie auf eine persönliche Ebene gezogen werden. Die RichterInnenwahl fürs Verfassungsrecht sei aber durchaus spannend, vor allem hinsichtlich des Zusammenhangs mit Trump. Es wird betont, dass die Judikative möglichst neutral agieren sollte und die Aussagen der Juristin geklärt worden seien. Es gehe um eine Top-End-Level-Wissenschaftlerin, die öffentlich durch den Dreck gezogen wird, weil sie verfassungstreu ist. Es wird betont, dass es auf die jeweilige Situation ankommt, ob einer Lehrerin das Tragen eines Kopftuchs untersagt werden kann, zum Beispiel an einer Brennpunktschule mit starken Spannungen zwischen verschiedenen Religionen. Es wird klargestellt, dass die Antwort der Juristin zum Thema Kopftuch keine persönliche Meinung, sondern eine juristische Einordnung war. Es wird bedauert, dass man sie als Verfassungsrichterin verliert, da sie verfassungstreu sei.
Verfassungsrechtliche Einordnung und Neutralität
01:49:12Es wird erklärt, dass der Staat sich nicht mit einer Religion identifiziert, wenn er das Tragen eines Kopftuchs zulässt. Das Kruzifix in bayerischen Schulklassen sei nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts grundsätzlich verfassungswidrig, weil es gegen das Neutralitätsgebot verstößt. Es wird betont, dass die Juristin jede Frage auf sachlich-juristischer Ebene beantwortet und sich nicht in persönliche Fragen hineinziehen lässt. Es wird hervorgehoben, dass sie es schafft, kein einziges Mal aus ihrer juristischen Rolle herauszufallen. Die juristische Szene lobe sie in den Himmel, weil sie fachlich sehr gut ist. Es wird als Farce bezeichnet, dass sie sich rechtfertigen muss. Es wird betont, dass es sich um ein Thema handelt, was die Menschen bewegt. Lanz versuche, etwas Persönliches aus ihr herauszubekommen, beiße sich aber seit 40 Minuten die Zähne aus. Es gehe am Ende auch um Vorbildfunktionen und um etwas, was viele Menschen in diesem Land bewegt, wenn sie Kinder an einer Schule haben, die ein Thema mit dem Kopftuch haben. Es wird erklärt, dass Juristen lernen, Privates auszuklammern, um für ihre PatientInnen da zu sein. Es wird betont, dass es nicht die Aufgabe der Juristin ist, Menschen abzuholen, sondern gute Entscheidungen zu treffen. Es wird Verständnis dafür geäußert, dass die Themen die Menschen bewegen und dass sich die Juristin viel mit Ehe und Familie, dem religiösen Kopftuch und dem Schwangerschaftsabbruch beschäftigt hat. Ihre Aufgabe sei es, einen Debattenbeitrag zu leisten und sich keine Gedanken darüber zu machen, wie Teile der Bevölkerung reagieren würden. Es wird befürchtet, dass vieles nicht ankommen wird, aber dass an ihr eine Verfassungsrichterin verloren gegangen ist.
Kontroverse um Schwangerschaftsabbruch und die Rolle der Menschenwürde
01:56:10Ein großer Teil der Debatte dreht sich um den Paragraphen 218 zum Schwangerschaftsabbruch. Es wird klargestellt, dass die Juristin nie gesagt habe, sie sei für einen Schwangerschaftsabbruch bis zur Geburt oder dass der Embryo kein Lebensrecht habe. Sie stehe noch zur Wahl und lasse sich nicht durch eine mediale Hetzjagd vertreiben. Es wird befürchtet, dass die Union sie aufgrund des Skandals absägen wird. Es wird betont, dass sie für eine Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs in der Frühschwangerschaft eingetreten sei. Dahinter stehe ein schwieriger Güterkonflikt zwischen den Grundrechten des Embryos und den Grundrechten der Frau. Für die Auflösung dieses Güterkonflikts sei entscheidend, dass die Grundrechte des Embryos und die Grundrechte der Frauen nicht in allen Phasen der Schwangerschaft gleich zu wichten seien. Wenn man das Lebensrecht des Embryos und die Grundrechte der Frau mit gleichem Schutz gegenüberstellt, könne man den Schwangerschaftsabbruch zu keiner Zeit rechtfertigen. Es wird auf das verfassungsrechtliche Dilemma hingewiesen, dass wenn man dem Embryo ab Nidation die Menschenwürde mit gleichem Schutz wie dem Menschen nach der Geburt zuerkennt, der Schwangerschaftsabbruch nicht zu rechtfertigen ist. Es wird betont, dass es mittlerweile Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts gibt, die sich mit ähnlichen Konflikten außerhalb des Schwangerschaftsabbruchs beschäftigt haben. Es wird kritisiert, dass viele Menschen nicht verstehen, dass sie es hier mit einer Juristin zu tun haben und ihre Worte als persönliche Meinung interpretieren. Es wird betont, dass im Koalitionsvertrag genau das steht, was die Juristin vorgeschlagen hat. Sie war Mitglied der Kommission für reproduktive Selbstbestimmung und Fortpflanzung, die von der Bundesregierung eingesetzt wurde, um zu prüfen, ob und wie eine Regulierung des Schwangerschaftsabbruchs außerhalb des Strafgesetzbuches aussehen kann. Es wird erklärt, dass die geltende Rechtslage so ist, dass ein Schwangerschaftsabbruch in den ersten zwölf Wochen straffrei ist, aber rechtswidrig. Die Konsequenz ist, dass es keine Kostenübernahme durch die gesetzliche Krankenversicherung gibt. Die Juristin will das nicht ändern, sondern sagt, dass der Schwangerschaftsabbruch aus verfassungsrechtlichen Gründen in den ersten Wochen rechtmäßig sein sollte.
Frauke Brosius-Gersdorf's Überlegungen zur Nominierung angesichts der Kampagne
02:19:07Die Frage nach dem Festhalten an der Nominierung ist nicht einfach, da die Belastungen enorm waren, aber die Unterstützung durch das Umfeld, Familie, Freunde und Kollegen, war fantastisch. Es geht nicht mehr nur um die eigene Person, sondern um die Auswirkungen solcher Kampagnen auf das Land und die Demokratie. Es muss abgewogen werden, wie das Bundesverfassungsgericht in Ruhe arbeiten kann. Tausende Zuschriften aus der Bevölkerung, Politik und Wissenschaft haben dazu aufgefordert, jetzt nicht zurückzustecken, da sich sonst solche Kampagnen durchsetzen könnten und die nächste Verfassungsrichterwahl gefährdet wäre. Sobald die Gefahr besteht, dass das Verfassungsgericht beschädigt wird, würde ich an meiner Nominierung nicht festhalten, da ich diesen Schaden nicht verantworten kann und auch keine Regierungskrise verursachen möchte. Patriotismus bedeutet Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und unsere Verfassung zu schützen. Das Verfassungsgericht und die Stabilität unserer Regierung stehen über meiner Richterinnenposition.
Reaktionen auf das Lanz-Interview und Erwartungen an die folgende Diskussion
02:22:56Das Lanz-Interview wird als herausragend gelobt. Im anschließenden Journalisten-Talk mit Anna Lehmann von der Taz und Marc-Felix Serrao von der NZZ werden unterschiedliche Positionen erwartet, wobei die Frage aufgeworfen wird, wie eine Position gegen die Verfassung aussehen könnte. Es wird die Befürchtung geäußert, dass der journalistische Talk die Situation eher verschlimmern könnte. Die Reden im Bundestag zum Thema werden kritisch betrachtet. Eine Rede der Linken wird als Meinungsdebatte kritisiert, während eine andere Rede als Hetze gegen eine Frau, weil sie pro-choice ist, wahrgenommen wird. Es wird betont, dass es um eine Juristin geht, die Recht einordnet und keine persönliche Meinung äußert. Die Absetzung aller Wahlen wird als Armutszeugnis kritisiert. Es wird hervorgehoben, dass Frau Brosius-Gersdorf im Richterwahlausschuss eine Zweidrittelmehrheit erhalten hat und das Problem in der Union verortet wird.
Analyse der Situation um Frauke Brosius-Gersdorf und die Rolle der CDU
02:30:41Frau Brosius-Gersdorf wird als Opfer eines Entrüstungssturms der letzten Wochen gesehen, in den sie unverschuldet geraten ist. Die CDU hat in dieser Situation viel falsch gemacht. Es wird diskutiert, ob Frau Brosius-Gersdorf mit ihren Positionierungen für das Bundesverfassungsgericht geeignet ist. Ein Auftritt in einer früheren Sendung, in dem sie sich zum Thema AfD-Verbotsverfahren geäußert hat, wird kritisch hinterfragt. Es wird argumentiert, dass sie sich als Rechtswissenschaftlerin geäußert hat und lediglich die Wehrhaftigkeit der Demokratie betont hat. Es wird ein Rollenwechsel vom politischen Akteur zum Richter gefordert, wie er auch bei anderen Richtern des Bundesverfassungsgerichts stattgefunden hat. Es wird betont, dass die Taz links und die NZZ rechts steht, was keinen Mehrwert für die Diskussion bringt. Es wird eine Experten-Einschätzung von Johannes Hilje bevorzugt.
Expertenmeinung zur Nichtwahl der Kandidaten und die Rolle der Medien
02:37:28Die Nichtwahl der drei Kandidaten wird als politisches und Kommunikationsdesaster betrachtet, da die Spitze der Union noch in einer Medienrealität des letzten Jahrhunderts lebt und den Einfluss rechtspopulistischer Alternativmedien unterschätzt. Jens Spahn wird dafür kritisiert, dass er die Dimension der Bedenken gegen eine der Kandidatinnen unterschätzt hat und die Notbremse zu spät gezogen hat. Trotz der Zurückweisung der Vorwürfe gegen Frau Brosius-Gersdorf durch einen Brief, adelt Spahn weiterhin die inhaltlich fundierten Bedenken. Merz macht die Richterwahl zu einer Gewissensentscheidung, was den Kritikern in den eigenen Reihen einen Freifahrtschein gibt. Spahn wird Vorwärtsverteidigung vorgeworfen, da er der SPD eine Mitschuld unterstellt, obwohl er den Personalvorschlag gemeinsam mit der SPD-Fraktion gemacht hat. Es wird betont, dass rechte Hetze und eine Kampagne von Rechtsextremen es geschafft haben, Abgeordnete der CDU und CSU dazu zu bringen, einen vorher geprüften Personalvorschlag platzen zu lassen.
Plagiatsvorwürfe gegen Frau Brosius-Gersdorf und die Rede von Britta Hasselmann
02:47:17Es gab auch Plagiatsvorwürfe gegen Frau Brosius-Gersdorf, die von einem sogenannten Plagiatsjäger erhoben wurden. Frau Brosius-Gersdorf hat ein Gutachten erstellen lassen, das sie entlastet. Das Gutachten kommt zu dem Schluss, dass die Vorwürfe unbegründet sind und keine Substanz haben. Es wird betont, dass die CDU und CSU die Plagiatsvorwürfe als Begründung für die Verhinderung der Wahl herangezogen haben. Die Dissertation von Frau Brosius-Gersdorf wurde bereits 1998 vorgelegt, was gegen ein Plagiat spricht. Die Rede von Britta Hasselmann wird als historisch und bedeutend für die Demokratie und das Bundesverfassungsgericht angesehen. Sie kritisiert Jens Spahn und Friedrich Merz für das Desaster und die Schäden, die dem Bundesverfassungsgericht und den Kandidierenden zugefügt wurden. Sie betont, dass rechte Newsportale Einfluss auf die Fraktion der CDU nehmen und die Karriere einer Frau gefährden.
Bewertung der aktuellen politischen Lage und Ausblick
02:57:26Es wird festgestellt, dass die aktuelle Situation eine riesige Gefahr für die Demokratie darstellt, da ein Angriff medial und durch rechte Kampagnen auf das Verfassungsgericht, die Verfassung und das demokratische System stattfindet. Es wird die Frage aufgeworfen, warum noch keine Demo angekündigt wurde. Es wird die Erwartung geäußert, dass die Regierung bis zum bitteren Ende durchgezogen wird, da weder SPD noch CDU/CSU ein Interesse daran haben, dass die Regierung scheitert. Es wird betont, dass die Angst vor der AfD eine Rolle spielt. Es wird kritisiert, dass die CDU immer noch denkt, dass die AfD durch die Ampel größer geworden ist. Es wird festgestellt, dass die Union viele AfD-politische Überzeugungen hat, aber nicht von der AfD geschluckt werden will. Es wird ein neues Monitor zum Thema Bürgergeld angekündigt, das analysiert, ob die Politik genug tut, damit Menschen in Arbeit kommen.
Monitor-Beitrag zum Thema Bürgergeld und Arbeitsgelegenheiten
03:02:34Der Monitor-Beitrag thematisiert das Dauerreizthema des arbeitsscheuen Bürgergeldempfängers und die Frage, ob die Politik genug tut, damit Menschen in Arbeit kommen. Es wird das Beispiel von Jörg Schnefel, genannt Locke, einem Bürgergeldempfänger mit einem 1-Euro-Job, gezeigt. Locke ist Stahlbauschlosser, kann aber auch Bagger fahren, Pflaster legen oder Maschinen reparieren. Aufgrund von Scheidung und Schulden ist er in einen 1-Euro-Job geraten. Immer mehr 1-Euro-Jobs werden gestrichen, da die Jobcenter mit drastischen Einschnitten kämpfen müssen. Es stehen 10 Millionen Euro weniger für aktive Eingliederungsmaßnahmen zur Verfügung. Fachleute sind sich einig, dass 1-Euro-Jobs für Menschen wie Locke Sinn machen, aber sie kosten Geld. Die Bundesregierung hat im Koalitionsvertrag ausreichende Mittel versprochen, aber der Etat wird nur um bescheidene 0,47 Prozent gesteigert, was eigentlich ein fettes Minus ist. Auch in Stuttgart werden immer weniger 1-Euro-Jobs angeboten. Es wird das Beispiel von Anna Gawaldig gezeigt, die im Stuttgarter Fairkauf arbeitet.
Upcycling-Fundstücke und Tauschregal
03:09:04Oftmals finden sich am Straßenrand Gegenstände, die andere Leute nicht mehr benötigen, darunter auch skurrile Dinge wie französische Karten zum Handlesen. Es werden auch Bücher und Kleidung gefunden, wobei die Kleidungsausbeute eher gering ist. Interessanter sind Geschirr und andere schöne Dinge zum Upcyceln. Sogar ein neuer Staubsauger wurde entdeckt, der noch getestet werden muss. Im Haus gibt es ein Tauschregal im Treppenhaus, wo Bewohner Gegenstände untereinander austauschen können. Vorsicht ist jedoch geboten, was man von der Straße mitnimmt, insbesondere Bettdecken und Matratzen. Der Tipp lautet, keine Unterwäsche von der Straße zu sammeln. Es wurde von erfolgreichen Flohmarktverkäufen berichtet, bei denen gefundene Gegenstände teuer verkauft wurden. Schubladen, die eingesammelt wurden, könnten für 25 Euro pro Stück auf Ebay Kleinanzeigen verkauft werden, besonders wenn sie noch bemalt werden. Eine Freundin hat auf dem Sisyphus Flohmarkt 300 Euro verdient. Es wird die Freude an der aktuellen Arbeit betont, bei der es weniger ums Geld geht, sondern um eine sinnvolle Aufgabe und Struktur im Leben. Es wird die Problematik von Ein-Euro-Jobs angesprochen, bei denen Menschen trotz geringer Bezahlung arbeiten gehen, um wieder in die Gesellschaft integriert zu werden.
Hürden und Chancen auf dem Arbeitsmarkt
03:11:29Die Geschichte von Anna Gawaldik, einer ausgebildeten Kauffrau mit Abitur, die aufgrund persönlicher Probleme ihren Weg zurück in den Arbeitsmarkt sucht, wird thematisiert. Ihr Fall verdeutlicht die Schwierigkeiten, mit denen Menschen nach Schicksalsschlägen zu kämpfen haben. Andrea Bartsch vom Caritasverband betont die Bedeutung von Stabilisierungsphasen, die Ein-Euro-Jobs bieten können, um wieder regelmäßig zu erscheinen und Verantwortung zu übernehmen. Es wird kritisiert, dass die Anzahl solcher Arbeitsgelegenheiten in Stuttgart gesunken ist. Der Fall von Markus Mayer, der seinen Ein-Euro-Job verloren hat, verdeutlicht die Problematik der Kürzungen in diesem Bereich. Er versteht nicht, warum gerade diese Maßnahme gekürzt wird, da sie eine Chance bietet, sich zu beweisen und auf das Arbeitsleben vorzubereiten. Es wird aufgedeckt, dass Jobcenter Gelder aus dem Topf für Eingliederungsmaßnahmen nehmen, um Verwaltungslücken zu füllen, was zu einer strukturellen Unterfinanzierung führt. Das Coaching von Klienten wird als teuer und personalintensiv, aber langfristig wirksam dargestellt, um Menschen mit langer Arbeitslosigkeit in den Arbeitsmarkt zu integrieren und dort zu halten.
Erfolgreiche Programme und populistische Debatten
03:16:31Daniela Lippke, die über das Programm nach §16i SGB II im Bonusmarkt arbeitet, verdeutlicht die Schwierigkeit, die komplexen Paragrafen und Gesetzmäßigkeiten zu durchblicken. Es wird kritisiert, dass es gute Angebote für Arbeitssuchende gibt, aber weniger für Bürgergeldempfänger. Der Bonusmarkt, betrieben von einer gemeinnützigen Gesellschaft, bereitet Menschen unter realistischen Bedingungen auf den Arbeitsmarkt vor. Daniela Lippke, alleinerziehend und sieben Jahre arbeitslos, erhielt hier eine Chance. Es wird die Benachteiligung von Eltern mit kleinen Kindern angesprochen und die Vorurteile, denen sie ausgesetzt sind. Tim Töpfer berichtet von einer hohen Vermittlungsquote in Rewe, Edeka und Co. Trotz des Erfolgsmodells profitieren immer weniger Menschen davon, da den Jobcentern die Mittel fehlen. Es wird die populistische Debatte auf Kosten der Schwächsten kritisiert und die Erzählung vom angeblich faulen Bürgergeldempfänger in Frage gestellt. Es wird betont, dass viele, die im Bonusmarkt waren, inzwischen regulär arbeiten und dass sich die Investition in diese Menschen für die Sozialkassen auszahlt.
Frauenfußball im Fokus: Vorurteile, Potenziale und Eigenständigkeit
03:28:06Es wird die Frage aufgeworfen, wie viele dumme Sprüche über Frauenfußball bereits gehört wurden und die Vorurteile, dass es niemanden interessiert und nicht so attraktiv ist wie Männerfußball. Es wird betont, dass sich dies im Jahr 2025 nicht mehr aufrechterhalten lässt, da Stadien ausverkauft sind und Zuschauerrekorde gebrochen werden. Trotzdem gibt es Unterschiede zwischen Männern und Frauen im Fußball, wie weniger Klubs in der 1. Bundesliga der Frauen und die Querfinanzierung durch Männerteams. Es wird die Frage aufgeworfen, ob der Frauenfußball mehr in den Mainstream gerückt werden sollte oder ob er seinen eigenen Weg gehen sollte. Es wird betont, dass Fußball einen großen Einfluss auf Politik und unser Leben hat. Es wird kritisiert, dass Frauen im Fußball geringere Voraussetzungen haben als Männer, z.B. bei der Bezahlung der Trikots und den Übungsplätzen. Es wird gefordert, dass der Frauenfußball sich vom Männerfußball emanzipiert und eine eigenständige Marke wird. Es werden drei Gründe genannt, warum der Frauenfußball sein eigenes Ding machen sollte: Anders sein, die Fans warten darauf und kein Bock mehr auf die zweite Reihe.
Partnerschaft mit Snox und Community-Aktionen
03:48:29Es wird die Partnerschaft mit Snox für Juli und August angekündigt und die lockere und angenehme Zusammenarbeit hervorgehoben. Es wird erwähnt, dass Snox jetzt auch Periodenunterwäsche anbietet, die getestet werden soll. Zudem sollen weitere Special Socken, wie die mit dem Regenbogen, bestellt werden, passend zum Pride-Monat. Snox verkauft Socken mit GOTS-Zertifizierung. Es werden verschiedene Sockenmodelle vorgestellt, wie die mit dem Mini-Statement, die Melone und die mit Feel the Love. Es wird darauf hingewiesen, dass es günstiger ist, mehr zu bestellen. Es wird betont, dass es sich um Fairtrade und Bio-Qualität handelt und dass der Code für zusätzlichen Rabatt genutzt werden kann. Es wird auf eine Frage zu den Nähten eingegangen und versichert, dass diese nicht stören. Für den CSD in Berlin wird angeboten, eine kleine Gruppe mitzunehmen. Es wird auf den Discord verwiesen, wo sich Interessierte melden können. Es wird angekündigt, dass die Nekki-Party erst nächste Woche Freitag stattfindet und der CSD nächste Woche Samstag ist. Es wird dazu aufgerufen, sich für die Teilnahme zu melden und auf die Threads im Discord zu achten, wo sich Gruppen in verschiedenen Städten bilden können.