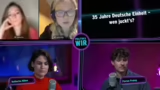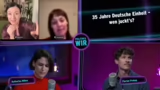Politik & wir ! MixTalk ! 35 Jahre Deutsche Einheit - wen juckt's? [!Thema]
35 Jahre Deutsche Einheit: Diskussion über Ost-West-Unterschiede im ARD-Mixtalk
Im ARD-Mixtalk analysieren Experten und Politiker 35 Jahre nach der Deutschen Einheit die noch bestehenden Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland. Themen sind Identität, mediale Darstellung, strukturelle Ungleichheiten, Lohngefälle, Rentenunterschiede und die Rolle der Treuhand. Es werden Lösungsansätze zur Stärkung der Einheit und zur Förderung von Chancengleichheit diskutiert, darunter eine Aufarbeitung der DDR-Geschichte, die Anerkennung von Leistungen im Osten und die Notwendigkeit einer gesamtdeutschen Verantwortung.
Begrüßung und Einführung in das Thema
00:10:42Der Stream beginnt mit einer herzlichen Begrüßung auf dem ARD-Kanal anlässlich des Tages der Deutschen Einheit. Katharina Röhm vom SWR und Florian Prokop vom RBB moderieren gemeinsam und betonen die Ost-West-Kooperation. Das Thema des heutigen Mixtalks ist '35 Jahre Deutsche Einheit – wen juckt's?'. Es wird das Publikum nach aktiven Erinnerungen an die Wiedervereinigung gefragt und auf eine Bundesweib-Reportage in der ARD Mediathek hingewiesen. Zuschauer können sich per Anklingeln-Button live in die Diskussion einschalten und Fragen an die Gäste stellen. Der Fokus liegt auf der aktuellen Bedeutung der Wiedervereinigung und den damit verbundenen Gefühlen und Diskussionen, anstatt sich ausschließlich auf die Vergangenheit zu konzentrieren. Es werden Bilder aus der Zeit des Mauerfalls gezeigt, um die Emotionen und die Euphorie dieser Zeit zu vermitteln und die Zuschauer zur Teilnahme am Gespräch anzuregen. Die Sendung möchte ergründen, inwiefern die Folgen der Wiedervereinigung noch relevant sind und was der Tag der Deutschen Einheit für die Menschen bedeutet.
Erster Gast Marike Reimann und Harkon über Ost-West-Identität
00:17:31Marike Reimann, geboren in Rostock und ehemalige Chefredakteurin beim SWR, teilt ihre persönlichen Erfahrungen und die ihrer Familie mit der Wiedervereinigung. Sie erinnert sich, wie sie als Kind ihrer Schwester die Wiedervereinigung anhand von Veränderungen beim Sandmann erklärte. Ihre Eltern verloren ihre Jobs und mussten sich neu orientieren, wobei westdeutsche Führungskräfte in Unternehmen oft eine Rolle spielten. Harkon, ein Streamer aus Hessen, der später nach Ost-Berlin zog, äußert sich ebenfalls zu den gezeigten Bildern und betont, dass die friedliche Natur der Wiedervereinigung positiv hervorzuheben ist. Es wird diskutiert, inwiefern Labels wie 'Ostdeutsch' und 'Westdeutsch' heute noch relevant sind. Florian Prokop merkt an, dass er sich nie als Ostdeutsch gefühlt habe, bis er im Westen als solcher wahrgenommen wurde. Marike berichtet von ähnlichen Erfahrungen und Vorurteilen, wie die Annahme, dass alle Ostdeutschen Sächsisch sprechen würden. Harkon ergänzt, dass er im Westen als Ostdeutscher und im Osten als Wessi bezeichnet wurde und mit Klischees über reiche westdeutsche Eltern konfrontiert wurde.
Bedeutung der Ost-Identität und Berichterstattung
00:24:16Es wird die Frage aufgeworfen, ob die Unterscheidung zwischen Ost und West an Bedeutung verliert. Der Bericht der Ostbeauftragten der Bundesregierung wird erwähnt, der besagt, dass die Identifikation mit Ostdeutschland weiterhin eine große Rolle spielt und möglicherweise sogar wieder wichtiger wird. Marike Reimann bestätigt dies und erklärt, dass die verstärkte Berichterstattung über Ostdeutschland oft mit negativen Anlässen wie hohen AfD-Wahlergebnissen zusammenhängt. Daraus sei jedoch eine neue, positive Diskussion über die Ost-Identität entstanden, mit Podcasts, Büchern und Streams, die sich dem Thema widmen. Im Chat äußern Zuschauer ähnliche Erfahrungen, wie die Frage nach der Herkunft und die damit verbundenen Vorurteile. Es wird kritisiert, dass im Geschichtsunterricht die DDR-Geschichte oft zu kurz kommt und die Nazi-Zeit sowie die französische Revolution überproportional behandelt werden. Marike bemängelt, dass die BRD-Geschichte oft als die gesamte Deutschland-Geschichte dargestellt wird und die unterschiedlichen historischen Punkte beider Staaten vernachlässigt werden.
Aufarbeitung der DDR-Geschichte und strukturelle Ungleichheiten
00:29:32Harkon kritisiert, dass die DDR-Geschichte im Schulunterricht oft nur oberflächlich behandelt wird und wichtige Themen wie die Treuhandanstalt kaum Beachtung finden. Er betont, dass die mangelnde Aufarbeitung der Treuhand ein Grund dafür ist, dass sich viele Ostdeutsche durch die Wiedervereinigung benachteiligt fühlen. Dies trage zur Unzufriedenheit bei, die von rechten Parteien wie der AfD ausgenutzt wird. Eine Umfrage zeigt, dass der Anteil derer, die der Meinung sind, dass Ost und West gut zusammengewachsen sind, seit 2020 gesunken ist. Marike erklärt, dass die AfD eine Nische besetzt, die von den etablierten Parteien vernachlässigt wurde, indem sie die Kommunikation über Social Media nutzt, um ihre Agenda in einfacher Sprache zu verbreiten. Sie kritisiert, dass bei der Wiedervereinigung versäumt wurde, die BRD auf den Prüfstand zu stellen und eine neue Verfassung oder Nationalhymne zu schaffen. Die strukturellen Ungleichheiten, wie Arbeitslosigkeit und Entwertung des Vermögens, haben dazu beigetragen, dass sich viele Ostdeutsche von den etablierten Parteien abgewendet haben.
Mediale Darstellung und strukturelle Repräsentation
00:35:47Marike Reimann kritisiert die Berichterstattung über Ostdeutschland und betont, dass ein Mangel an ostdeutschen Führungskräften in den Medien dazu führt, dass Geschichten oft aus einer westdeutschen Perspektive erzählt werden. Sie verweist auf Studien, die zeigen, dass der Osten oft an der westlichen Norm gemessen wird und stereotype Bilder von Trabis und Plattenbauten reproduziert werden. Die Sprache in der Berichterstattung habe sich von einer Aufbruchsstimmung zu negativen Begriffen wie Arbeitslosigkeit gewandelt. Harkon ergänzt, dass Ostdeutsche in den Medien oft negativ dargestellt werden, indem man nach Extrembeispielen sucht und Klischees über Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit reproduziert. Er wünscht sich eine Berichterstattung auf Augenhöhe, die den Menschen zuhört und ihre Probleme ernst nimmt. Marike stimmt zu und erklärt, dass viele Ostdeutsche sich von den überregionalen Medien abwenden, weil sie sich nicht angesprochen fühlen. Sie lobt jedoch einige aktuelle Dokumentationen, die ostdeutsche Geschichten auf Augenhöhe erzählen.
Wege zur Einheit und Lösungsvorschläge
00:43:51Es wird diskutiert, wie die Einheit zwischen Ost und West gestärkt werden kann. Marike Reimann schlägt einen Kongress vor, um die strukturellen Ungleichheiten zu benennen und Role Models zu fördern, die offen zu ihrer ostdeutschen Herkunft stehen. Sie fordert spezielle Förderprogramme und Stipendien, um Ostdeutsche und Menschen mit Migrationshintergrund zu unterstützen. Zudem betont sie die Notwendigkeit einer klaren Verurteilung des Rechtsextremismus in allen Bundesländern. Harkon schlägt vor, das Lohngefälle zwischen Ost und West abzuschaffen, da die Lebenskosten mittlerweile identisch sind. Er fordert eine Aufarbeitung der Treuhandanstalt und die Anerkennung der Leistungen der Betriebe in der DDR. Marike ergänzt, dass es wichtig ist, die wirtschaftlichen Ungleichheiten anzugehen, da Ostdeutsche im Durchschnitt weniger verdienen und weniger Vermögen besitzen. Sie betont die Bedeutung von Netzwerken und Kontakten, die Ostdeutschen oft fehlen, und fordert eine Ansprache auf Augenhöhe in den Medien und der Gesellschaft.
Lohngefälle, Rentenunterschiede und Treuhand
00:48:15Harkon betont die Notwendigkeit, das Lohngefälle zwischen Ost und West nach 35 Jahren endlich abzuschaffen, da die Lebenskosten mittlerweile nahezu identisch sind. Er spricht auch die Rentenunterschiede an, ist sich aber in diesem Punkt nicht ganz sicher. Es werden Grafiken eingeblendet, die deutschlandweit Unterschiede in verschiedenen Bereichen zeigen, wie Sparquote, mittleres Einkommen und Erbschaften. Diese verdeutlichen, dass der Osten in vielen Bereichen schlechter abschneidet. Harkon wiederholt seine Forderung nach einer Aufarbeitung der Treuhand und der Anerkennung der Leistungen der Betriebe in der DDR-Zeit. Er hat sich die Reportage nochmal angeschaut, wie Betriebe, die hochprofitabel waren, nach der Währungsunion billig gekauft und abgewickelt wurden.
Anerkennung von Leistungen in der DDR und regionale Politik
00:50:21Es wird betont, dass man Leistungen der DDR anerkennen sollte, wie z.B. Betreuungsschlüssel in Kitas oder nachhaltigere Produktion, auch wenn diese nicht aus ökologischen Gründen entstanden ist. Es wird kritisiert, dass oft pauschal gesagt wird, im Osten sei nicht gearbeitet worden. In Bezug auf Politikerinnen aus dem Osten, die im Stream zu Gast sind, wird der Wunsch geäußert, dass auch jemand von der Linken eingeladen wird. Es wird bemängelt, dass Parteien oft westdeutsche Politiker in den Osten schicken, die die regionalen Gegebenheiten nicht verstehen. Politik funktioniere heutzutage über eine emotionale Bindung zu Personen aus der Heimat, sei es aus dem Sportverein oder der Nachbarschaft. Es wird als Fehler angesehen, wenn westdeutsche Politiker in Ostdeutschland den Ton angeben wollen. Parteien sollten regional stärker mit eigenen Kandidaten agieren und eventuell eine Ostquote einführen. Ein Zuschauerkommentar hebt hervor, dass auch nach 35 Jahren die ehemalige Grenze noch deutlich sichtbar ist, z.B. bei Löhnen, Führungspositionen und Unternehmensgewinnen, was zu Frustration führt.
Erinnerungskultur und gesamtdeutsche Verantwortung
00:53:32Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die Aufarbeitung der deutschen Teilung und die damit verbundene Erinnerungskultur hauptsächlich auf der Ostseite stattfindet. Clara Küppers, Teil der Bundesweib-Reportage, schildert ihre Erfahrungen als "Wossi" mit Eltern aus Ost- und Westdeutschland, betont den Gemeinschaftssinn und den Willen zum Aufbauen, der in ihrer Familie gelebt wurde. Sie sieht es als Vorteil, das Beste aus beiden Kulturen vereinen zu können. Im Geschichtsunterricht im Westen werde der Mauerfall oft nicht behandelt, was zu mangelnden Berührungspunkten mit der Thematik führe. Es wird kritisiert, dass die Verantwortung für die Aufarbeitung der Vergangenheit oft dem Osten zugeschrieben wird. Ein Zuschauerkommentar fordert, dass strukturelle Probleme in der Bundespolitik ankommen müssen, um eine Besserung zu erreichen. Es wird betont, dass der Westen aufhören muss, westzentrisch zu denken und die Probleme des Ostens als gesamtdeutsches Problem anzuerkennen. Unterschiede zwischen Ost und West sollten nicht nur aushalten, sondern auch als Chance gesehen werden, voneinander zu lernen und etwas Neues Gemeinsames zu schaffen.
Wiedervereinigung als fortlaufender Prozess und politische Dimensionen
01:01:18Es wird diskutiert, dass Wissen und Geschichte der deutschen Teilung hauptsächlich auf ostdeutscher Seite präsent sind und junge Menschen im Westen mehr Verantwortung übernehmen sollten, um an der "Wiedervereinigung" zu arbeiten. Damit ist gemeint, negative Ungleichheiten abzubauen und strukturelle Rückstände im Osten zu beseitigen. Es wird die Frage aufgeworfen, inwieweit die westdeutsche Jugend sich für das Thema interessiert. Paartherapeutin Ilka Hoffmann-Biesinger wird hinzugezogen, um über Herausforderungen in Ost-West-Paarbeziehungen zu sprechen. Sie betont, dass Unterschiede in Beziehungen generell vorkommen und nicht spezifisch für Ost-West-Paare sind, obwohl strukturelle Unterschiede wie Vermögensungleichheit eine Rolle spielen können. Die Kennenlerngeschichte von Claras Eltern, die durch eine Brieffreundschaft zwischen Bonn und Potsdam entstand, wird als positives Beispiel für den Austausch zwischen Ost und West hervorgehoben. In einem Gedankenexperiment wird die Situation eines Paares, das Ost- und Westdeutschland repräsentiert, analysiert, wobei Ostdeutschland sich nicht ausreichend beteiligt fühlt und Westdeutschland sich für alles verantwortlich gemacht sieht. Ilka betont die Bedeutung von Empathie und dem Verständnis der unterschiedlichen Realitäten des Partners.
Austausch, Wertschätzung und politische Verantwortung
01:08:34Es wird betont, dass ein Austausch auf Augenhöhe und gegenseitiges Zuhören notwendig ist, um Vorurteile abzubauen und Wertschätzung füreinander zu entwickeln. Politiker sollten jedoch nicht wie Paartherapeuten agieren, da sie wiedergewählt werden wollen und somit nicht neutral sein können. Stattdessen sollte in der Politik mehr Raum für verschiedene Identitäten geschaffen werden. Ein Zuschauerkommentar warnt vor Verallgemeinerungen und betont, dass es nicht "den Westen" oder "den Osten" gibt, sondern individuelle Biografien. Theresia Krone, ebenfalls aus der Bundesweib-Reportage, betont, dass die deutsche Einheit sie persönlich betrifft, da sie ohne diese nicht existieren würde. Sie kritisiert, dass das Privileg, Abitur zu machen oder zu studieren, in der DDR oft an die politische Linie der SED gebunden war. Sie fordert eine umfassendere Aufklärung über die DDR-Vergangenheit und die Ereignisse nach der Wiedervereinigung. Es wird betont, dass Schule nur ein kleiner Teil der gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Thema ist und dass auch Medien und andere Institutionen eine Rolle spielen müssen. Theresia berichtet von positiven Erfahrungen in einer NDR-Talkshow, wo Menschen aus Ostdeutschland das Gefühl hatten, mit ihrer Biografie gesehen zu werden.
Emotionale Narrative und Problembewusstsein
01:31:56Es wird über emotional aufgeladene Narrative über den Osten gesprochen, die im Westen fest verankert sind. Es wird diskutiert, wie schwer es ist, diese Perspektiven aufzunehmen. Der Chat wird nach seiner Meinung zum Problembewusstsein gefragt. Prof. Dr. Sabrina Zajak wird als Expertin hinzugezogen. Sie forscht zu Globalisierungskonflikten, Arbeit und sozialen Bewegungen. Es wird erörtert, wie stark sich Menschen mit den Labels 'ostdeutsch' oder 'westdeutsch' verbunden fühlen, abhängig von Zugehörigkeitsgefühlen und Verwurzelung. Umfragen zeigen, dass im Osten eher eine starke Ostidentität vorherrscht, während im Westen eher eine deutsche Identität betont wird. Dies spiegelt wider, dass die Wiedervereinigung im Westen weniger thematisiert wird, während sie im Osten noch im Identitätsbewusstsein präsent ist. Eine starke identitäre Zugehörigkeit korreliert mit der Wahrnehmung ostdeutscher Benachteiligungen. Unterschiede in Einkommen, Sparmöglichkeiten und Erbschaften werden angesprochen, ebenso wie die Unterrepräsentation in Führungspositionen, wie der Elitenmonitor der Universität Leipzig-Jena und der Hochschule Zittau-Görlitz zeigt. Die Zahlen zur Unterrepräsentation Ostdeutscher in Spitzenpositionen werden diskutiert, wobei festgestellt wird, dass diese eigentlich bekannt sind. Es wird betont, dass sich Elitentransfer langsam vollzieht und die Unterrepräsentation erklärt, aber auch, dass Durchlässigkeit in bestimmten Sektoren möglich ist, insbesondere dort, wo Demokratie stärker verankert ist.
Elitentransfer und Netzwerke
01:38:14Die Ereignisse der 1990er Jahre, insbesondere der Elitentransfer, werden als Ursache für die anhaltende Unterrepräsentation Ostdeutscher in Führungspositionen genannt. Viele Führungspositionen im Osten wurden abgeschafft und durch westdeutsche ersetzt, was als undemokratisch kritisiert wird. Es wird argumentiert, dass sich diese Strukturen verfestigt haben und durch geschlossene Netzwerke reproduziert werden. Qualifikation allein reiche nicht aus, um aufzusteigen, da Vitamin B eine entscheidende Rolle spielt. Das Elternhaus, die besuchten Schulen und Vereine prägen den Weg. Eine Frage aus dem Chat thematisiert Vorurteile gegenüber typisch ostdeutschen Vornamen und deren Auswirkungen auf Karrierechancen. Studien zeigen, dass Namen, die nicht deutsch klingen, auf dem Arbeitsmarkt benachteiligen. Es wird die Frage aufgeworfen, was sich die Teilnehmenden von der Politik wünschen, um das Zusammenwachsen von Ost und West zu fördern. Es wird gefordert, dass sich Politiker mit den Fakten auseinandersetzen und die Bedeutung für das reale Leben der Menschen erkennen. Präsenz vor Ort und Offenheit für innovative Formate zur Bürgerbeteiligung seien wichtig. Politiker müssen sich vor Ort zeigen, da politische Kämpfe auf kommunaler Ebene verloren gehen. Das Versagen der Mainstream-Parteien stärke andere Kräfte. Es wird eine Einschätzung zum Stand der Deutschen Einheit erfragt, wobei die Meinungen von Sabrina und Nicole auseinandergehen (60% vs. 50%).
Politikerinnen diskutieren über Einheit
01:46:44Josefine Ortle (SPD), Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags, wird begrüßt, hat aber technische Probleme. Paula Pichotter (Grüne) und Nora Salz (CDU) werden ebenfalls begrüßt. Paula Pichotter kritisiert, dass es im Koalitionsvertrag von Union und SPD kein explizites Kapitel zu Ostdeutschland gibt und sieht darin ein Zeichen, dass das Thema an Bedeutung verloren hat. Sie betont, dass Ostdeutsche im Bundestag in der Minderheit sind und es schwierig ist, eigene Interessen durchzusetzen. Nora Salz hingegen wünscht sich kein eigenes Kapitel, sondern ein gemeinsames Kämpfen der Abgeordneten aus dem Osten für die Region. Sie betont die geringe Anzahl ostdeutscher Abgeordneter in der Regierung. Ein Positionspapier der Ostdeutschen Landesverbände der CDU fordert eine angemessene Vertretung von Ostdeutschen in Führungspositionen. Nora Salz betont, dass die Politik nur bedingt den Rahmen steuern kann und es auch eine intrinsische Motivation braucht. Sie berichtet von ihren positiven Erfahrungen im Ehrenamt beim Deutschen Fleischerverband, wo sie als Frau aus dem Osten ernst genommen wurde. Paula Pichotter entgegnet, dass es in der Politik relativ gut funktioniere, da Menschen von unten nach oben gewählt werden. Sie berichtet von ihren Erfahrungen in der Hochschulmedizin, wo sie im Westen Diskriminierung erfahren hat und in den Osten zurückgekehrt ist. Sie betont, dass in Bereichen wie Wirtschaft und Medien oft Menschen gefördert werden, die den Vorgesetzten ähnlich sind. Ostdeutsche hätten oft nicht die gleichen gesellschaftlichen Codes erlernt wie westdeutsche Führungskräfte.
Quoten, Vermögenssteuer und Umverteilung
01:57:18Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Ostquote eine Lösung für die Unterrepräsentation in Führungsebenen sein könnte. Nora Salz ist kein Quoten-Fan, während Paula Pichotter Quoten als eine der wenigen Möglichkeiten sieht, etwas zu verändern. Sie verweist auf Förderprogramme für Ostdeutsche in der Bundesverwaltung und die Bedeutung von Bundesbehördenstandorten im Osten. Zudem spricht sie die Chance auf einen Elitenaustausch in der Justiz an, da viele Richter aus den 90er Jahren in Rente gehen. Paula Pichotter spricht sich dafür aus, dass man klagen können muss, wenn man aufgrund seiner ostdeutschen Sozialisation bei Bewerbungen benachteiligt wurde. Es wird die Frage aufgeworfen, ob eine Quote nicht mehr Spaltung bringen könnte. Die Diskussion kommt auf die Vermögenssteuer und die ungleiche Verteilung von Vermögen und Erbschaften. Nora Salz berichtet von ihren persönlichen Erfahrungen mit einem geerbten Haus, das mit Schulden verbunden ist. Sie warnt davor, mit der Vermögenssteuer die Falschen zu treffen und fordert eine differenziertere Gesetzgebung. Paula Pichotter betont, dass bei einer Reform der Erbschaftssteuer darauf geachtet werden muss, dass der Osten nicht leer ausgeht und ein Umverteilungsmechanismus geschaffen werden muss. Sie argumentiert, dass die Vermögensunterschiede ein massiver Quell von Unzufriedenheit sind und die Ostdeutschen wenig dafür können.
![Politik & wir ! MixTalk ! 35 Jahre Deutsche Einheit - wen juckt's? [!Thema]](/static/thumb/video/ard4d178-480p.avif)