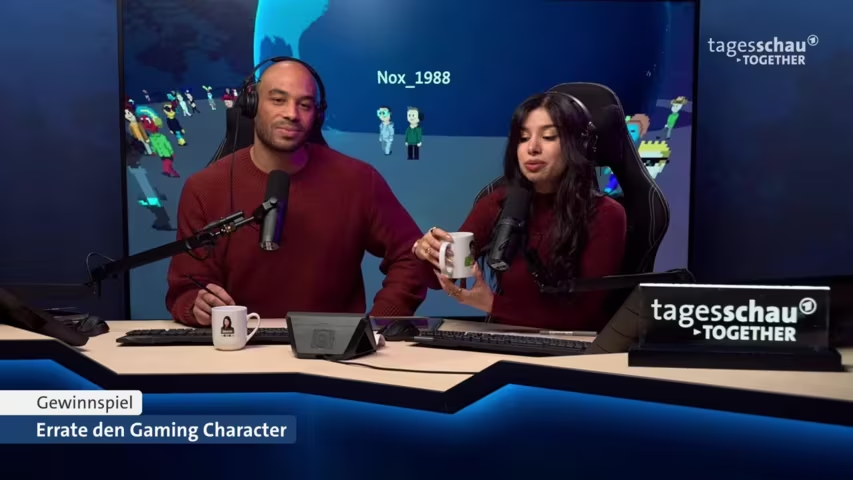COP 30 in Brasilien: Xenia Böttcher live aus Belèm I tagesschau together
COP 30 in Brasilien: Klimaziele und indigene Proteste im Fokus
Die Weltklimakonferenz COP 30 in Belém, Brasilien, ist ein zentrales Thema, bei dem sich die Weltgemeinschaft auf Klimaziele einigen will, um die Erderwärmung auf unter 1,5 Grad zu begrenzen. Xenia Böttcher gibt Einblicke in die Verhandlungen über globale Klimaanpassungsziele und die Herausforderungen bei der Finanzierung des globalen Südens. Indigene Völker stürmten das COP-Gelände, um auf ihre Rolle als Hüter des Waldes und die Bedrohung ihrer Territorien durch illegalen Minenabbau aufmerksam zu machen.
Einführung und Themenübersicht von Tagesschau Together
00:10:25Hanin und Felix begrüßen die Zuschauer zu „Tagesschau Together“, dem interaktiven Community-Format der Tagesschau. Sie kündigen zwei relevante Themen der Woche an: die Weltklimakonferenz COP 30 in Belém, Brasilien, und die Sicherheitslage auf deutschen Weihnachtsmärkten. Zudem wird ein Gewinnspiel vorgestellt und die gemeinsame Ausstrahlung der Tagesschau um 20 Uhr erwähnt. Das Format ist live auf verschiedenen Plattformen wie Twitch, TikTok, Instagram, YouTube und in der ARD Mediathek verfügbar, wobei die Zuschauer interaktiv per Mail oder Fax (mit Kanalpunkten auf Twitch) teilnehmen können. Es wird auch auf die Möglichkeit hingewiesen, sich als Avatar im Stream zu präsentieren und die Bedeutung von Channel Points für die Teilnahme am Gewinnspiel wird erklärt.
Gewinnspiel und Interaktionsmöglichkeiten
00:15:59Felix und Hanin erläutern die Details des Gewinnspiels, bei dem eine Susanne-Daubner-Tasse gewonnen werden kann. Die Teilnahme erfordert das Erraten eines Gaming-Charakters, wofür im Laufe des Streams Hinweise gegeben werden. Jeder Teilnehmer hat fünf Faxe zur Verfügung, wobei ein Fax 300 Kanalpunkte kostet, die man durch das Folgen des Kanals erhält. Es wird betont, dass die Faxe primär für das Gewinnspiel gedacht sind, um die Gewinnchancen nicht zu mindern. Zudem wird auf die vorübergehende Deaktivierung der Kommentarfunktion auf TikTok und Instagram aufgrund von Hate-Kommentaren hingewiesen, während ein konstruktiver Austausch auf Twitch weiterhin erwünscht ist. Die Moderatoren beantworten auch Fragen zur Häufigkeit des Formats und kündigen weitere Streams an, darunter einen Weihnachts-Stream am 18. Dezember.
Vertiefung der Stream-Inhalte und journalistischer Anspruch
00:24:33Die Moderatoren gehen auf die Entwicklung von Tagesschau Together ein, das sich stets weiterentwickelt hat, beispielsweise durch die Einführung von Gewinnspielen und Behind-the-Scenes-Einblicken. Sie betonen den journalistischen Anspruch des Formats, aktuelle Themen zu beleuchten und den Zuschauern die Möglichkeit zu geben, Fragen direkt an Korrespondenten und Experten zu stellen. Als Hauptthemen werden die Klimakonferenz in Belém und die Sicherheitslage auf Weihnachtsmärkten genannt. Es wird auch eine Umfrage gestartet, ob die Zuschauer planen, Weihnachtsmärkte zu besuchen. Die Moderatoren erklären, dass der Sinn des Streams darin besteht, Jugendliche in Kontakt mit Journalismus zu bringen und einen Austausch über aktuelle Themen zu fördern, wobei sie selbst als ausgebildete Journalisten agieren.
Tagesschau-Nachrichten: Wehrdienst, Rente und Lieferkettengesetz
00:30:45Die Tagesschau um 20 Uhr beginnt mit Susanne Daubner und behandelt mehrere wichtige nationale und internationale Themen. Ein zentrales Thema ist der neue Wehrdienst in Deutschland, der auf Freiwilligkeit setzt, aber bei unzureichenden Zahlen verpflichtende Elemente einführen könnte. Ab 2008 geborene Männer müssen einen Fragebogen ausfüllen und zur Musterung. Die AfD und Linke kritisieren den Kompromiss. Ein weiteres Thema ist die Finanzierung der Rente, wobei die Regierung ein Milliardenpaket beschlossen hat, das von Wirtschaftsverbänden als unbezahlbar kritisiert wird. Zudem wird über das EU-Lieferkettengesetz berichtet, dessen Auflagen für Unternehmen abgeschwächt wurden, was zu Kritik an der Zusammenarbeit der Parteien im EU-Parlament führte. Die EVP hatte die Änderungen mit Stimmen von Rechtsaußenparteien durchgesetzt, was als Tabubruch gewertet wird. Der weltweite CO2-Ausstoß erreicht einen neuen Höchststand, was die Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad unrealistisch erscheinen lässt.
Gedenken an die Pariser Terroranschläge und Sport/Wetter
00:42:14Die Tagesschau erinnert an die Terroranschläge in Paris vor zehn Jahren, bei denen am 13. November 2015 Islamisten 130 Menschen töteten. Mit Schweigeminuten und Gedenkfeiern an den Anschlagsorten, darunter das Bataclan und das Stade de France, wird der Opfer gedacht. Präsident Macron besuchte die Orte, und ein Gedenkgarten wird eingeweiht. Korrespondent Michael Strempel berichtet live vom Place de la République über die ruhige und bewegende Atmosphäre. Im Sportteil wird über die deutsche Fußball-Nationalmannschaft berichtet, die die WM-Qualifikation perfekt machen will, wobei Kapitän Kimmich verletzt ausfällt und Baku sowie Thar seine Positionen übernehmen. Die Wettervorhersage kündigt für den nächsten Tag fast frühlingshaftes Wetter im Süden und Regen im Norden an, mit kühleren Temperaturen zum Wochenende hin.
Rückkehr zu Tagesschau Together und Gewinnspiel-Erklärung
00:48:01Hanin und Felix begrüßen die Zuschauer zurück bei Tagesschau Together, insbesondere die neuen Zuschauer, die von der 20-Uhr-Tagesschau dazugekommen sind. Sie wiederholen die Plattformen, auf denen der Stream verfügbar ist (Twitch, TikTok, Instagram, YouTube, ARD Mediathek) und die Möglichkeit, per Mail zu interagieren. Die Hauptthemen des Streams, die Weltklimakonferenz in Belém, Brasilien, und die Sicherheitslage auf Weihnachtsmärkten, werden erneut genannt. Anschließend wird das Gewinnspiel detaillierter erklärt: Zuschauer können eine doppelseitig bedruckte Susanne-Daubner-Tasse gewinnen, indem sie einen Gaming-Charakter erraten. Dafür werden drei Hinweise im Laufe des Streams gegeben. Die Teilnahme erfordert 300 Channel Points pro Fax, die man durch das Folgen des ARD Twitch-Kanals erhält, und jeder Teilnehmer hat maximal fünf Faxe.
Weltklimakonferenz in Brasilien: Ziele und Herausforderungen
00:51:45Die Weltklimakonferenz in Belém, Brasilien, ist ein zentrales Thema, bei dem Xenia Böttcher als Korrespondentin Einblicke gibt. Sie erklärt, dass die Konferenz die Weltgemeinschaft zusammenbringt, um die Erderwärmung auf unter 1,5 Grad bis 2100 zu begrenzen. Dies wird mit einer WG verglichen, die Regeln für das Zusammenleben festlegt. Aktuell geht es um technokratische globale Klimaanpassungsziele, um Länder bezüglich ihrer Anpassung an die Erderwärmung vergleichbar zu machen. Dabei werden Faktoren wie die Verfügbarkeit von Krankenhäusern in Hitze- und Dürregebieten berücksichtigt. Ein weiteres großes Thema ist die Diskrepanz zwischen den freiwilligen Klimazielen der Länder und dem tatsächlich notwendigen Tempo zur Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels. Zudem wird über die finanzielle Unterstützung des globalen Südens durch Industrieländer gesprochen, um Anpassungsmaßnahmen und Investitionen in erneuerbare Energien zu ermöglichen, wobei die bisher zugesagten 300 Milliarden Dollar als viel zu gering angesehen werden.
Organisatorischer Ablauf der Weltklimakonferenz und Indigene Proteste
00:58:53Die Weltklimakonferenz ist eine Konferenz von Staaten, die die Agenda festlegen. Neben öffentlichen Diskussionsforen und Länderpavillons finden die eigentlichen Verhandlungen in den Delegationsbüros statt, wo „Real Politics“ betrieben wird, um gemeinsame Ziele zu erreichen. Die Gespräche werden als konstruktiv beschrieben, im Gegensatz zum Vorjahr. Ein signifikanter Vorfall war der Protest indigener Völker, die das COP-Gelände stürmten. Dies geschah überraschend spät am Abend, als die offiziellen Gespräche bereits beendet waren. Der symbolische Akt sollte darauf aufmerksam machen, dass indigene Völker als Hüter des Waldes nicht ausreichend gehört und geschützt werden, obwohl sie eine entscheidende Rolle im Klimaschutz spielen. Trotz der gewaltsamen Natur des Protests, der nicht abgesprochen war, unterstützen viele indigene und afro-brasilianische Völker das übergeordnete Anliegen, gehört zu werden.
Indigene Perspektiven und Herausforderungen in Brasilien
01:03:04Xenia Böttcher interviewt Pakak, einen Vertreter eines indigenen Volkes aus dem Südosten Brasiliens. Pakak betont die Bedeutung der Zivilgesellschaft bei der COP und die Notwendigkeit, demokratische Rechte wahrzunehmen. Er hebt hervor, dass indigene Völker und traditionelle Gemeinden im Einklang mit der Natur leben und diese schützen, was statistisch belegt ist. Jedoch sind sie zahlreichen Gefahren ausgesetzt, wie dem illegalen Minenabbau in ihrem Territorium, der ihr Wasser verseucht und Krankheiten verursacht. Pakak fordert Schutzgebiete für indigene Territorien, um ihre Rechte zu stärken und das Eindringen von Außenstehenden zu verhindern. Er kritisiert die Gewalt bei den Protesten, da sie dem Anliegen der Indigenen, friedlich gehört zu werden, widerspricht. Trotz der historischen Beteiligung indigener Völker bei dieser COP, empfindet er den Eindruck von Gewalt als kontraproduktiv für ihre Sache.
Politische Entscheidungen und ihre Auswirkungen auf indigene Völker
01:13:41Indigene Völker werden in die Konferenz eingebunden, jedoch nicht in dem Maße, wie sie es sich wünschen. Brasilien hat eine Ministerin für indigene Angelegenheiten, und Präsident Lula fordert finanzielle Hilfen von der Weltgemeinschaft, um die Völker im Wald zu unterstützen. Diese Unterstützung ist notwendig, da die indigenen Gemeinschaften durch den Schutz des Waldes eine globale Klima-Regulierungsfunktion erfüllen. Ein kontroverser Punkt ist die gleichzeitige Nachricht, dass die Entwaldung im Amazonas zurückgeht, während Präsident Lula dem staatlichen Ölunternehmen Petrobras erlaubt hat, vor der Küste des Amazonas nach Öl zu suchen. Diese Doppelstrategie, einerseits den Wald zu schützen und andererseits fossile Brennstoffe zu fördern, stößt bei indigenen Gemeinschaften und Umweltorganisationen auf starke Kritik und wird als fatales Zeichen gewertet.
Herausforderungen im Korrespondentenberuf und Verhandlungen bei der COP
01:15:59Xenia Böttcher spricht über die Herausforderungen ihres Berufs als Korrespondentin. Sie empfindet es als Privileg, reisen zu können und menschliche Geschichten zu erzählen, insbesondere um junge Menschen zu erreichen. Die Arbeit in Brasilien ist von Freude über die kulturelle Vielfalt geprägt. Schwierige Momente entstehen jedoch bei der Berichterstattung über menschliches Leid, wie etwa bei Menschenrechtsverletzungen oder Todesfällen. Sie erinnert sich an einen Polizeieinsatz in Rio de Janeiro mit vielen Toten, der das Team tief betroffen machte. Bezüglich der Delegationsgespräche bei der COP beschreibt sie diese als ein Pokerspiel, bei dem Länder über verschiedene Themen hinweg verhandeln und Blockaden einlegen, um ihre Interessen durchzusetzen. Industrieländer sind sich ihrer historischen Verantwortung für den Klimawandel bewusst und zeigen Bereitschaft zur finanziellen Unterstützung der Entwicklungsländer, jedoch bleiben die genaue Höhe und die Modalitäten der Zahlungen umstritten. Ein Beispiel für die Komplexität ist die Einstufung Chinas und Indiens als Entwicklungsländer, obwohl China der größte Treibhausgasemittent ist.
Sicherheitslage auf Weihnachtsmärkten und der Prozess in Magdeburg
01:29:47Der Stream wendet sich dem Thema Weihnachtsmärkte und deren Sicherheitslage zu. Lars Frohmüller berichtet über den Magdeburger Weihnachtsmarkt, dessen Eröffnung bis zuletzt auf der Kippe stand. Das Sicherheitskonzept wurde erneut überprüft und musste nachgeschärft werden, insbesondere bezüglich der Zufahrtssperren und der Anzahl des Sicherheitspersonals. Dies geschieht ein Jahr nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt. Lars Frohmüller schildert die Ereignisse des Anschlags, bei dem der Täter mit einem Fahrzeug über das Gelände fuhr, über 300 Passanten verletzte und sechs Menschen tötete. Die Fahrt dauerte 64 Sekunden, fühlte sich für die Betroffenen jedoch wie eine Ewigkeit an. Der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter hat begonnen, und die Details des Geschehens werden erneut aufgerollt, was für die Prozessbeteiligten eine schwere Belastung darstellt. Lars war selbst vor Ort und musste das Leid miterleben.
Prozesstage und die Reaktion des Täters
01:33:08Die ersten beiden Prozesstage waren stark vom Täter geprägt, der sich narzisstisch und öffentlichkeitswirksam zeigte, indem er beispielsweise einen Laptop mit Botschaften hochhielt. Gleichzeitig wurden die ersten Stunden des Prozesses genutzt, um sich mit jedem einzelnen Opfer zu beschäftigen und die erlittenen körperlichen Schäden detailliert darzulegen, was für Anwesende, insbesondere Journalisten und Nebenkläger, schwer zu ertragen war. Viele brachen in Tränen aus oder verließen den Saal, während die Reaktion des Täters kühl, kalt und abgestumpft blieb. Seine ersten Einlassungen konzentrierten sich auf seine politischen Motivationen und zeigten wenig Mitleid, abgesehen von einer Entschuldigung bei den Eltern des neunjährigen Opfers. Auch am zweiten Prozesstag stand seine Vergangenheit und Motivation im Vordergrund, wobei er weiterhin emotionslos auf die Tat reagierte.
Motivlage und Gutachten des Täters
01:35:47Die Motivlage des mutmaßlichen Täters ist komplex und steht im Fokus des Prozesses. Das Gericht geht davon aus, dass der Täter aus Gekränktheit über jahrelange verlorene Zivilprozesse gegen eine Flüchtlingshilfe in Köln handelte und die Tat als Ausweg sah. Demgegenüber stehen Gutachten, wie das von Hans Goldenbaum aus Halle, die eine politische oder terroristische Motivation nahelegen. Das Gericht lehnt diese Einschätzung zunächst ab, doch könnte sich dies im Laufe des Verfahrens noch ändern. Die Aussagen des Täters sind oft konfus und schwer nachvollziehbar, was die Klärung der genauen Beweggründe erschwert. Ein Psychologe beobachtet den Täter im Gerichtssaal, da dieser im Vorfeld Gutachten abgelehnt hatte, um psychische Hintergründe und mögliche weitere Faktoren der Tat zu ergründen.
Technische Aspekte und zukünftige Erwartungen an den Prozess
01:37:23Im Prozess wurde ein Kfz-Gutachten vorgestellt, das technische Manipulationen am Tatfahrzeug, einem BMW, ausschloss. Es stellte sich heraus, dass der Täter den Bremsassistenten durch wiederholtes Betätigen des Gaspedals überschrieben hatte. Die Frage nach der Motivation des Täters bleibt weiterhin zentral. Ein Psychologe, dessen Gutachten der Täter im Vorfeld ablehnte, ist nun im Gerichtssaal anwesend, um den Täter zu beobachten und mögliche psychische Hintergründe zu ergründen. Bezüglich einer möglichen Abschiebung des Täters wurde klargestellt, dass er im Falle einer Verurteilung seine Haftstrafe in einem deutschen Gefängnis verbüßen wird und eine Abschiebung derzeit nicht zur Debatte steht.
Stimmung in Magdeburg und Sicherheitsbedenken bei Weihnachtsmärkten
01:39:03Die Stimmung in Magdeburg bezüglich des Weihnachtsmarktes ist gespalten. Viele Betroffene des Anschlags und deren Angehörige können sich nicht vorstellen, den Weihnachtsmarkt wieder zu besuchen. Andere Magdeburger sehen den Besuch des Weihnachtsmarktes als Zeichen, dass der Täter nicht gewonnen hat. Lars betont, dass diese zwei Gedanken in der Stadt präsent sind. Holger Schmidt, Sicherheitsexperte, schließt sich der Diskussion an und rät zu Gelassenheit, obwohl er die Risiken terroristischer Anschläge nicht leugnet. Er argumentiert, dass viele andere Lebensrisiken statistisch wahrscheinlicher sind und man sich nicht von Angst das Leben zerstören lassen sollte. Er selbst freut sich auf die Weihnachtsmärkte in seiner Heimat Baden-Württemberg.
Verantwortung und Kosten für Sicherheitskonzepte
01:42:57Die Frage nach der Zuständigkeit für Sicherheitskonzepte auf Weihnachtsmärkten und Großveranstaltungen ist komplex. Während die Gefahrenabwehr primär Aufgabe der Polizei ist, wird zunehmend diskutiert, ob auch Veranstalter kommerzieller Events in die Pflicht genommen werden sollten, da sie Einnahmen generieren. Holger Schmidt vertritt die Ansicht, dass Veranstalter, die Geld verdienen, einen Beitrag zur Sicherheit leisten sollten, betont aber gleichzeitig, dass die Polizei für bewaffnete Sicherheitsmaßnahmen zuständig sein muss. Er warnt vor einem „Teufelskreis“ immer höherer Sicherheitsanforderungen, die teuer werden und möglicherweise nie absolute Sicherheit garantieren können. Es sei wichtig, ein Gleichgewicht zu finden, um die Freiheit und Gelassenheit der Gesellschaft nicht zu opfern.
Verbesserungen der Sicherheitsmaßnahmen und Herausforderungen
01:45:56In Magdeburg war ein Problem, dass der Attentäter über einen Zugang in den Weihnachtsmarkt fuhr, der für Rettungskräfte offen gehalten wurde. Dies verdeutlicht das Dilemma zwischen hermetischer Abriegelung zum Schutz vor Anschlägen und der Notwendigkeit, schnelle Zugänge für Notfälle zu gewährleisten. Holger Schmidt betont, dass es keine perfekte Sicherheit gibt und jede Maßnahme eine Abwägung darstellt. Er weist darauf hin, dass die Diskussion in Magdeburg nach einem Jahr von großer Angst geprägt ist, aber niemand absolute Sicherheit garantieren kann. Er plädiert dafür, trotz der schrecklichen Ereignisse eine gewisse Gelassenheit zu bewahren, da Freiheit und Gelassenheit wichtige Werte sind.
Standardisierung von Sicherheitskonzepten und Terrorismusstrategien
01:48:08In Deutschland gibt es Bestrebungen, Sicherheitskonzepte für Weihnachtsmärkte zu standardisieren, inklusive Barrieren und Aufprallgeschwindigkeiten. Holger Schmidt weist jedoch darauf hin, dass Terrorismus sich ständig weiterentwickelt und Terroristen stets versuchen, neue Methoden zu finden, um Angst zu verbreiten. Er vergleicht dies mit der Akzeptanz von Risiken im Alltag, wie beim Autofahren, die gelernt und bewertet werden. Terrorismus zielt darauf ab, unsere Gedankenspiralen zu unterbrechen und ein Gefühl der Unsicherheit zu erzeugen, indem er immer wieder neue Bedrohungsformen wie Flugzeuge, Fahrzeuge oder Messer nutzt. Das Ziel ist, uns Angst zu machen und uns zu veranlassen, unsere Lebensweise aus Furcht zu ändern.
Diskussion über Sicherheits- und Sozialkompetenz in Schulen
01:55:55Ein Zuschauer schlug die Einführung eines Faches „Sicherheits- und Sozialkompetenz“ in Schulen vor. Holger Schmidt befürwortet dies, wenn es darum geht, Gelassenheit, Selbstbehauptung und Souveränität zu lernen, sowie Antikonflikt-Training anzubieten. Er lehnt jedoch eine Ausrichtung ab, die an frühere Wehrsportkunde erinnert. Schmidt betont, dass man sich von schrecklichen Ereignissen nicht dazu bringen lassen sollte, die Gesellschaft insgesamt zu verändern. Terroristen wollen durch Angst und Schrecken eine Veränderung der Gesellschaft von innen heraus bewirken, da sie ihre Vorstellungen nicht durch Wahlen oder Überzeugung durchsetzen können. Wenn die Gesellschaft aus Angst ihre Lebensweise ändert, gewinnen die Terroristen.